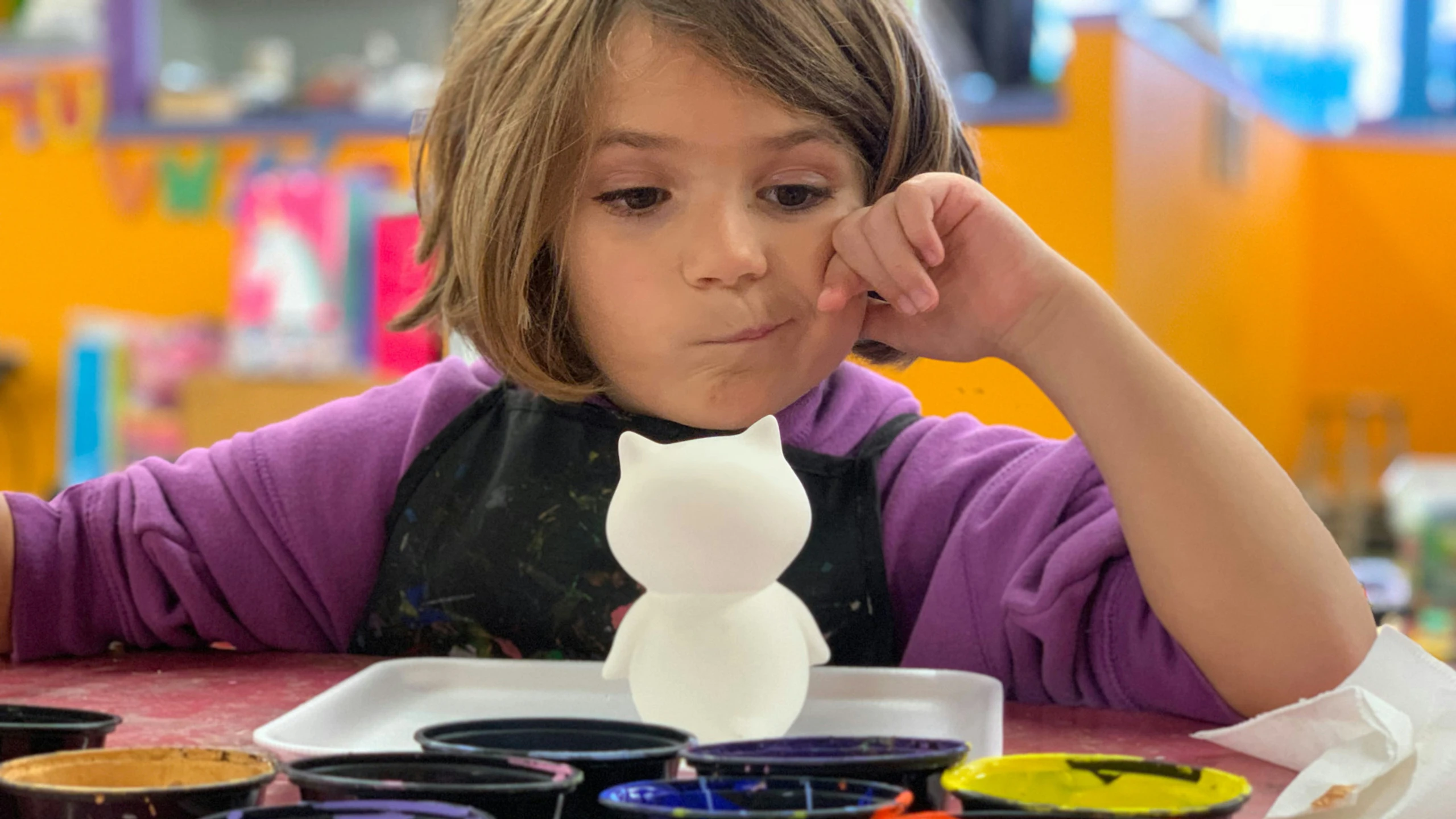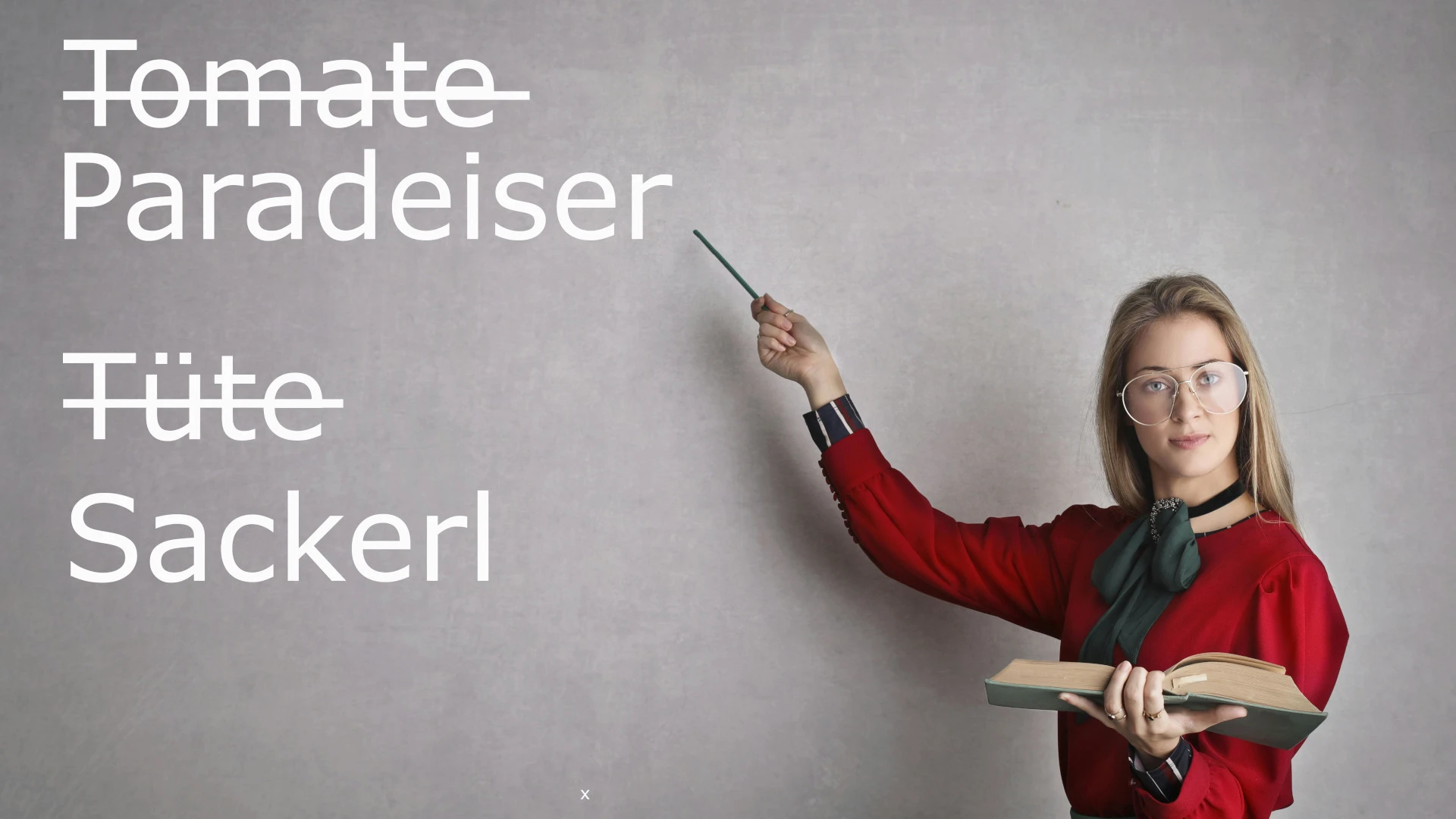Der Bildungsexperte Andreas Salcher legt ein neues Buch vor, in dem er Eltern praktische Tipps gibt und zugleich Kritik an Österreichs Schulsystem äußert. Im News-Interview erklärt er, von wem die notwendigen Reformen angestoßen werden müssten, wie sich künstliche Intelligenz sinnvoll in den Unterricht integrieren lässt und wie gut er selbst in der Schule war.
Seine kundige Streitschrift „Der talentierte Schüler und seine Feinde“ wurde zum Standardwerk, nun folgt nach etlichen weiteren Erfolgstiteln „Das Beste für mein Kind – Schule erfolgreich meistern“. Der „Überlebensratgeber durch den Dschungel des österreichischen Schulsytems“, wie er selbst sagt.
Ein Titel mit Zeug zum Longseller. Denn die Verunsicherung ist groß. Bildungsexperte Salcher wird immer häufiger von besorgten Eltern frequentiert und fasst nun die dringendsten Fragen und Antworten zusammen. Was muss ich bei der Schulwahl beachten? Wie kann ich die Talente meines Kindes fördern? Wie erkenne ich, dass es hochbegabt ist oder an ADHS leidet? News hat den Bildungsexperten zum Interview in seinem Büro in der Wiener Innenstadt getroffen.
Herr Salcher, was ist der Gedanke hinter Ihrem neuen Buch?
Es ist eine Art Überlebensratgeber durch den Dschungel des österreichischen Schulsystems, in dem ich versuche, alle relevanten Fragen zu beantworten. Ich werde zum Beispiel sehr oft gefragt, ob ich eine gute Schule empfehlen kann. Es war mir aber auch wichtig, Themen wie ADHS, Teilleistungsstörungen und Legasthenie anzusprechen, oder auch die Frage, ist mein Kind wirklich hochbegabt und wie kann ich das testen? Wenn unser Schulsystem so funktionieren würde, wie es sollte, und sich nämlich an den Interessen der Schüler orientiert, dann brauchen wir dieses Buch nicht. Aber ich fürchte, es wird ein Longseller sein.
Neben konkreten Tipps üben Sie auch Kritik an Österreichs Schulsystem. Zum Beispiel am Notensystem. Gibt es nicht nachhaltigere Lösungen als die Leistungen menschlicher Individuen in ein Raster von 1 bis 5 einzuteilen?
Ich war fünf Jahre ehrenamtlich als Kurier-Schüleranwalt tätig und habe sehr viel Feedback von Schülern gekriegt. Der Großteil der Schüler hat nichts gegen Noten. Was die Schüler fordern, ist Transparenz und Gerechtigkeit.
Gibt es bessere Lösungen?
Absolut. Ich beschreibe sie auch im Buch. Die Alemannenschule Wutöschingen in Baden-Württemberg, eine meiner absoluten Vorbildschulen, hat Gelingensnachweise eingeführt. Die Schüler lernen dort nicht im Klassenverbund, sondern primär eigenständig mit Lernbausteinen. Und wenn ein Schüler das Gefühl hat, dass er einen Lernbaustein bewältigt hat, dann meldet er sich bei seinem Lehrer, der zugleich sein Coach ist und wird geprüft. Das finde ich ein wesentlich besseres System.a


Das Buch
Bildungsexperte Andreas Salcher gibt in „Das Beste für mein Kind“ verunsicherten Eltern praktische Tipps. edition a, € 24
Sie beschreiben in Ihrem Buch KI als Hilfsmittel und geben Tipps, wie man KI vor allem auch als Elternratgeber nutzen kann, um sich leichter zu tun bei bestimmten Aufgaben. Sehen Sie die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler durch die Anwendung von Tools wie ChatGPT wichtige Aufgaben verlernen?
Das ist wie mit der Zahnpasta. Wenn die einmal aus der Tube heraus ist, kriegst du sie nicht mehr zurück. Man kann ChatGPT nicht verbieten und ich halte das Handyverbot, ehrlich gesagt, für einen Verzweiflungsversuch. An sich ist künstliche Intelligenz eine der wichtigsten Zukunftstechnologien, wenn nicht überhaupt die wichtigste. Zu sagen, ich isoliere die Schule davon, das halte ich für sinnlos. Man muss massiv in die Ausbildung der Lehrer investieren. Ein guter Lehrer hat überhaupt kein Problem mit KI, wenn er sie gemeinsam und transparent mit den Schülern nutzt.
Wie sollte man KI in der Schule verwenden?
Was ChatGPT zum Beispiel sehr gut kann, ist Lernpläne und Lernstrategien zu entwickeln, Zusammenfassungen, etc. Dagegen spricht überhaupt nichts. Ich verwende auch ChatGPT. Natürlich gibt es Gefahren, weil man das Denken irgendwann verlernt und bequem wird. Deswegen gebe ich Tipps, was Eltern machen können, wie sie sich informieren können, wo die Gefahren liegen und so weiter. KI kann uns unterstützen, aber die Bereitschaft zu lernen, die kann uns Technologie Gott sei Dank noch nicht abnehmen.
Sie schreiben viel darüber, dass man die Motivation fürs Lernen oft durch zwischenmenschliche Beziehung mit der Lehrperson aufbaut. Ist diese große Aufgabe den Lehrern wirklich zumutbar?
Das ist keine Aufgabe, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn es ein Naturgesetz des Lernens gibt, dann dass Lernen über Beziehung stattfindet. Wenn es Lehrern nicht gelingt, eine persönliche, wertschätzende Beziehung zu ihren Schülern aufzubauen, findet Lernen nicht statt. Gute Lehrer unterrichten keine Gegenstände, sondern unterrichten Schüler. Problematisch sind vor allem die veralteten Lehrpläne, die angefüllt sind mit Stoff. Die wirklich guten Schulen, die ich kenne, befreien ihre Lehrer davon, Lehrpläne stur einzuhalten und Stoff zu machen. Ich bin für die totale Abschaffung der Lehrpläne. Man sollte lieber individuelle Lernpfade entwickeln, für jeden Schüler.
Ihr Buch will Eltern helfen, mit dem Schulsystem besser zurechtzukommen. Warum ist das Verhältnis zwischen Eltern und Schule so verhatscht?
Das Wort, das in dem Buch am meisten vorkommt, ist Wertschätzung. Und es gibt sehr wohl Direktoren und Lehrer, denen es gelingt, wertschätzende Beziehungen in der Schulgemeinschaft aufzubauen. Wenn das einmal funktioniert, dann ist schon viel getan. Aber das Problem sind die ein, zwei, drei Minderleister, die es an jeder Schule gibt, die Katastrophenlehrer*. Ich gebe in meinem Buch Tipps, wie man mit ihnen umgehen kann.
*Katastrophenlehrer
Salcher rät, die Lehrkraft zunächst zu kontaktieren und sich dann mit anderen Eltern auszutauschen. Die nächsten Instanzen sind Schulleitung und Schulqualitätsmanager.
Umgekehrt gibt es aber auch Katastropheneltern. Und die Klage, dass die Zusammenarbeit mit Eltern immer schwieriger wird …
Das stimmt natürlich. Wenn man an Eltern mit migrantischem Hintergrund denkt, die Direktorinnen nicht die Hand geben wollen oder Vorladungen ignorieren.
Oder an Akademiker-Eltern, die meinen, ihr Kind sei das klügste und begabteste.
Das war für manche Eltern auch eine überraschende Erkenntnis, als sie während der Pandemie auf einmal ihr Supergenie die ganze Zeit zu Hause hatten und darauf gekommen sind, dass es sich vielleicht doch nicht um von den Lehrern unterdrückte Hochbegabung handelt. Ich bezeichne das österreichische Schulsystem ja gerne als Fernlerninstitut mit Anwesenheitspflicht. Die Gymnasien schneiden zum Großteil leistungsmäßig nur deshalb besser ab, weil die Bildungseltern, vor allem die Mütter, jeden Tag mit ihren Kindern lernen. Wenn sie das nicht tun würden, will ich mir gar nicht vorstellen, wie PISA ausschauen würde. Ich fordere seit vielen Jahren, dass Mütter, die selbst keine Matura haben, aber ein Kind zur Matura bringen, das Matura-Zeugnis gleich mit ausgestellt bekommen. Sie haben es sich redlich verdient.
Der Aufwand, den Sie von den Eltern fordern, ist aber immens. Sie empfehlen zum Beispiel auch einen Umzug in eine Region, wo es gute Schulen gibt. Wie sollen Eltern die Ressourcen dafür aufbringen?
Ich empfehle das nicht, ich sage nur, dass es so praktiziert wird. Eltern planen ihren Umzug aufgrund von Schulen. Oder sie melden ihr Kind bei den Großeltern oder am eigenen Arbeitsplatz an, wenn dort eine gute Schule in der Nähe ist. Das ist absurd. Aber es gibt tatsächlich Gegenden, in denen 90 Prozent der Kinder in den öffentlichen Schulen dem Unterricht nicht folgen können.
Sie schreiben viel über die Schule der Zukunft, die sich stärker mit den einzelnen Schülern auseinandersetzt und sich mit der Gegenwart mitwandelt. Sollte man überhaupt noch Hoffnung auf so eine Reform haben?
Es gibt einzelne hervorragende Schulen. Es ist nicht so, dass wir nicht wissen, wie es geht. Das Erschreckende ist, dass es nur ganz wenige Schulsysteme gibt, die sich dem 21. Jahrhundert angepasst haben. Ich finde, Kanada hat zum Beispiel ein sehr gutes Schulsystem. Singapur ist bekannt, mit einem sehr leistungsorientierten Schulsystem. Die Finnen sind berühmt dafür, wie sie ihre Lehrer auswählen. Von zehn Bewerbern wird es einer. Estland ist Vorreiter in Europa – mit einem Bildungsbudget, das deutlich unter der Hälfte des österreichischen liegt.
Ein Bildungsminister alleine kann ein System nicht ändern, es braucht einen nationalen Konsens
Von wem sollte eine Veränderung im besten Fall ausgehen?
Die großen Schulreformen auf der Welt sind immer vom Premierminister ausgegangen, der sie konsequent und unabhängig davon, welche Partei den Bildungsminister stellt, umgesetzt hat. So würde es eigentlich gehen. Ein Bildungsminister alleine kann ein System nicht ändern, es braucht einen nationalen Konsens. Das Bildungssystem müsste eine von drei nationalen Top-Prioritäten werden. Nur dann kann das gelingen.
Für wie wahrscheinlich halten Sie das in Österreich?
Österreich gehört zu den Ländern, wo zusätzlich zu allen anderen Reformwiderständen einfach eine extreme Parteipolitisierung des Schulsystems vorhanden ist. Die vielen guten Anläufe, die es gegeben hat, wurden nie zu Ende realisiert. Dabei haben wir das zweithöchste Bildungsbudget pro Kind in Europa.
Wie sollte das Budget besser eingesetzt werden?
Wir müssten massiv in unsere Elementarpädagoginnen in den Kindergärten investieren. Jeden Euro, den man dort investiert, multipliziert sich. Wir haben viel zu große Gruppen in den Kindergärten. Wir haben zwar genug Elementarpädagoginnen, die die Ausbildung machen, manche treten aber überhaupt nie in den Beruf ein, andere treten völlig frustriert und überfordert wieder aus. (Elementarpädagoginnen habe ich nicht gegendert, sondern es sind einfach zu über 90 % Frauen).
Und warum geht so viel Geld verloren?
Es gibt drei große Kostenfaktoren. Wir haben ziemlich genau 6.000 Schulen, von denen sind aber 1.500 Klein- und Kleinstschulen, die teilweise acht oder zwölf Schüler haben. Die Erhaltung solcher Schulen kostet. Wir haben ein Lehrerdienstrecht, das teuer ist. Wir haben 14 Wochen unterrichtsfreie Zeit und geben im Jahr trotzdem durchschnittlich 300 Millionen für Lehrerüberstunden aus. Außerdem haben wir eine viel zu aufwendige Schulverwaltung. Der Budgetdruck ist gewaltig. Und große Veränderungen passieren ja in der Politik immer nur dann, wenn es wehtut. Also ich meine, dass es aus Kostengründen sein könnte, dass man das System überdenkt.
Gestatten Sie zum Schluss die Frage: Waren Sie eigentlich selbst gut in der Schule?
In dem Buch schreibe ich über die Geschichte mit meiner Volksschullehrerin. Ich musste öfter die Klasse wechseln und landete irgendwann bei einer sehr traditionellen Lehrerin, die noch dazu großen Wert auf Schönschreiben gelegt hat. Und das war schon damals nicht meine Kernkompetenz. In der dritten Klasse habe ich meinen ersten Aufsatz geschrieben. Er trug den Titel „Erdäpfel mit Mauselöchern“. Zu meiner großen Überraschung hat mich diese Lehrerin bei der Hand gepackt, ist mit mir schnurstracks zum Direktor gegangen und hat vor mir zu ihm gesagt, das ist der beste erste Aufsatz, den sie bisher gelesen hat. Und ich erzähle die Geschichte deshalb gerne, weil: Seit diesem Tag war ich ein guter Schüler, weil diese hervorragende Lehrerin zwischen dem, wie ich schreibe und was ich schreibe, unterscheiden konnte.
Andreas Salcher, 64
Andreas Salcher ist ein österreichischer Bildungsexperte, Autor und Unternehmensberater, der sich als Kritiker des österreichischen Bildungssystems etabliert hat. Geboren 1960, studierte er Betriebswirtschaft und arbeitete zunächst in der Unternehmensberatung, bevor er sich ganz der Bildungsreform widmete.
Salcher gründete die „Sir Karl Popper Schule“, mit der er innovative Bildungskonzepte entwickelt und umsetzt. Er plädiert für mehr Autonomie der Schulen und eine stärkere Fokussierung auf individuelle Talente.
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 36/2025 erschienen.