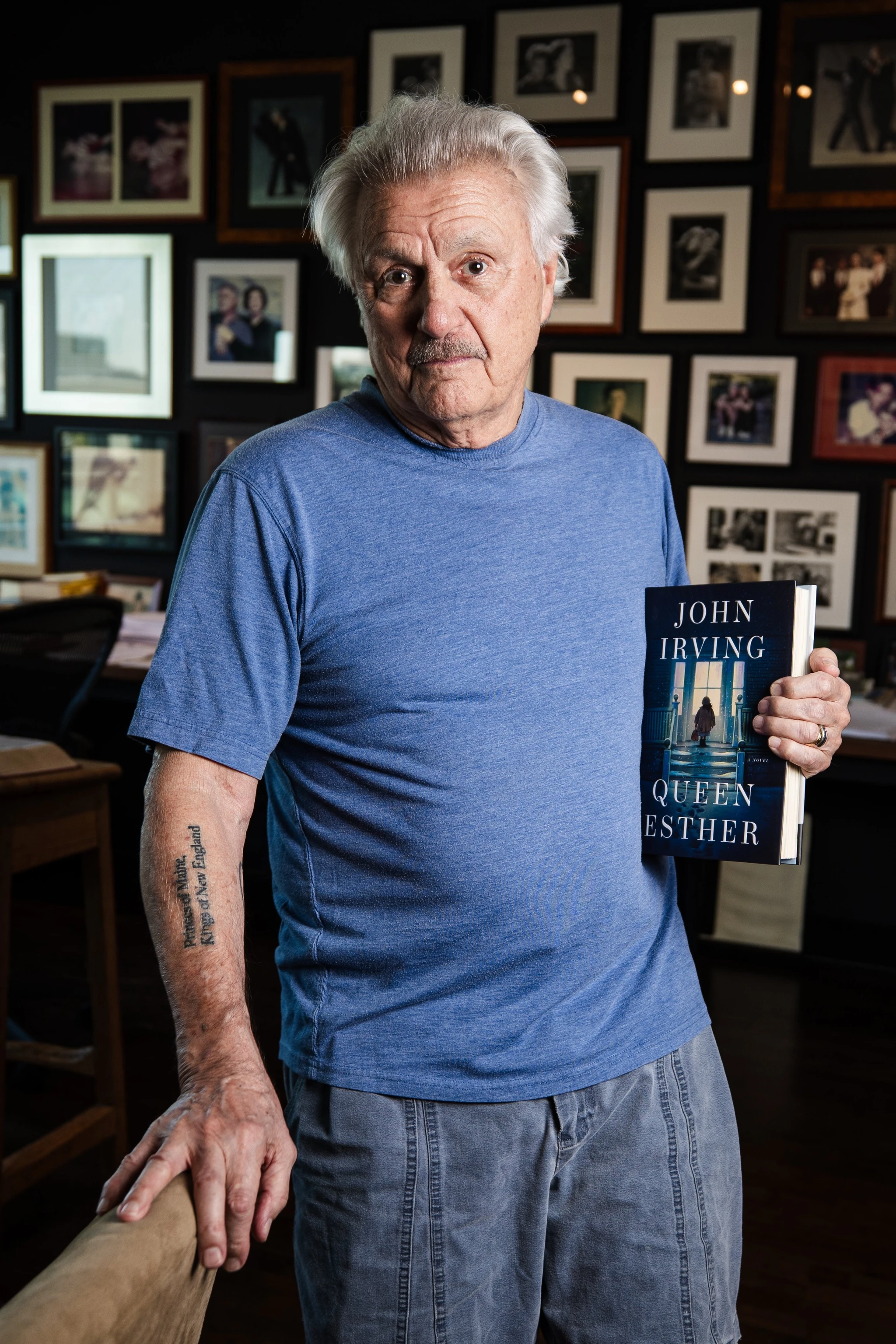Rekordpreis und Rekordreaktionen: Gustav Klimts „Bildnis Elisabeth Lederer“ erzielt 236 Mio. Dollar – eine Summe, die Experten als „crazy“, „Schallmauer“ und dennoch erwartbar einordnen. Warum dieser Zuschlag den Kunstmarkt verändert und welche Rolle Wien dabei spielt.
von
„Das ist natürlich crazy!“ – So kommentierte Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums im Wiener Museumsquartier, am Mittwochmorgen den in der Nacht von Gustav Klimts „Bildnis Elisabeth Lederer“ in New York erzielten Rekordpreis in der Höhe von 236 Mio. Dollar. Das Durchbrechen der 200-Millionen-Grenze habe ihn „sehr gewundert“, meinte er gegenüber der APA. „Der Zuschlag ist extrem hoch. Das ist ein Investment. Die Gambling-Mentalität hat Einzug gehalten.“
Kunst als Statussymbol
Kunst sei seit geraumer Zeit ein Statussymbol für jene, die es sich leisten können, sagte der Museumsdirektor, der vermutet, dass der Zuschlag an einen Bieter im arabischen oder asiatischen Raum gegangen ist. Er hoffe, „dass es die Öffentlichkeit wieder zu sehen bekommt“.
In jedem Fall sollten die weltweiten Schlagzeilen über den Rekordzuschlag, der Klimt nach Leonardo da Vinci zum zweitteuersten Künstler bei Auktionen machte, das Interesse für die Kunst aus „Wien um 1900“ weiter ansteigen lassen, glaubt er. „Dieses Interesse hat sich schon bisher kontinuierlich gesteigert“, meinte er unter Verweis auf hohe Besucherzahlen ausgewählter Werke des Leopold Museums in Seoul und Tokio. „Kunst ist neben der Musik ganz klar zum Attraktor für die Destination Wien geworden. Insofern ist so ein Ergebnis natürlich auch Werbung.“
Wipplinger: „So ein Ergebnis ist Werbung“
Erstaunt zeigte sich Wipplinger, dass „Bildnis Elisabeth Lederer“ bei der Eröffnung des von Architekt Marcel Breuer (1902-1981) an der Upper East Side gebauten früheren Whitney Museums als neues Headquarter von Sotheby's zwar ein 20-minütiges Bietergefecht auslöste und hoch angesteigert wurde, die beiden angebotenen und qualitativ hochstehenden Klimt-Landschaften aber nach deutlich geringeren Ansteigerungen zugeschlagen wurden: „Blumenwiese“ erzielte 86 Millionen Verkaufspreis, „Waldabhang in Unterach am Attersee“ 70,76 Mio. Dollar. „Bei beiden hätte ich erwartet, dass sie um die 100 Millionen weggehen werden.“ Die beiden Studien für das Porträt von Adele Bloch-Bauer gingen um 520.700 bzw. 482.600 Dollar weg.
Alle Werke stammen aus der Sammlung des verstorbenen Milliardärs Leonard A. Lauder. Sein jüngerer Bruder Ronald Lauder, ehemaliger US-Botschafter in Wien, gründete mit der „Neuen Galerie“ in New York eine Institution, die für die weltweite Bekanntheit Klimts enorm viel getan hat und in der auch das von ihm 2006 um kolportierte 135 Mio. Dollar gekaufte Porträt „Adele Bloch-Bauer I“ zu sehen ist. Lauder ist heute 81 Jahre alt. Wird dereinst wohl auch seine Sammlung auf den Markt kommen? Da stecke nicht nur viel Geld, sondern auch so viel Herzblut drinnen, dass eine spätere Zerschlagung wohl ausgeschlossen sei, mutmaßt Wipplinger. „Ich gehe davon aus, dass diese Werke auch künftig der Öffentlichkeit zugänglich sein werden.“
Natter: „Trophäenkunst“
Wie Wipplinger hat auch Klimt-Experte Tobias Natter, 2011 bis 2013 künstlerischer Direktor des Leopold Museums, die New Yorker Auktion nicht live verfolgt, sondern erst in den Morgenstunden vom Rekordergebnis erfahren. „Mit 200 Millionen Dollar ist sicher eine Schallmauer durchbrochen worden“, räumte auch er dem Ereignis historische Dimension ein. „Wenn man sich aber dagegen die Transfersummen für manche Fußballer vor Augen führt, relativiert sich das wieder.“ Für Natter handelt es sich bei Werken in dieser „astronomischen Höhe“ um „Trophäenkunst“, die auch die auffallende Ungleichheit einer wirtschaftlichen Entwicklung vor Augen führte, in der Reiche immer reicher würden, viele aber mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hätten.
Laut Natter habe es im Vorfeld der Auktion eine starke Konkurrenz der Auktionshäuser um das Werk gegeben und sei eine Summe von 150 Mio. Dollar garantiert worden. Angesichts dieser Summen könne man sich fragen, warum Gustav Klimts unvollendet gebliebenes Spätwerk „Bildnis Fräulein Lieser“ im Wiener Auktionshaus im Kinsky im Vorjahr mit 35 Mio. Euro weit unter den Erwartungen geblieben sei. Der Kauf soll später aufgrund neu aufgetauchter Erbenforderungen rückabgewickelt worden sein.
Weidinger: „Könnte in Abu Dhabi auftauchen“
Klimt-Experte Alfred Weidinger, Direktor der OÖ Landes-Kultur GmbH, zeigte sich gegenüber Ö1 „nicht wirklich überrascht“ über den Rekordpreis: „Man orientiert sich bei solchen Trophäenwerken vorwiegend am Weltmarktpreis“, also am höchsten zuletzt erzielten Wert. Derzeit würden viele Museen der dritten Generation, wie sie etwa jüngst in den Arabischen Emiraten entstanden sind, Hauptwerke suchen. Eines der drei gestern versteigerten Bilder „könnte in absehbarer Zeit in Abu Dhabi auftauchen“, glaubt der Experte.
Am Kunstmarkt gebe es derzeit drei Arten von Käufern: Syndikate aus Geschäftsleuten, die Kunst aus Spekulationsgründen erwerben, Museen der dritten Generation und schließlich „bestimmte Sammler, die eine derartige Trophäe wirklich haben wollen“. Klimt stehe wie kein anderer Künstler auf der ganzen Welt für Wien um 1900. Seine Arbeiten seien „unglaublich dekorativ, sehr leicht verständlich und gut les- und fassbar“, so Weidinger. Auch habe Klimt den dargestellten Personen "eine immer noch zeitgemäße Psychologie" verpasst, zudem spiele auch das biografische Schicksal der Dargestellten eine Rolle. „Das passt gut zusammen“, so Weidinger im „Morgenjournal“.