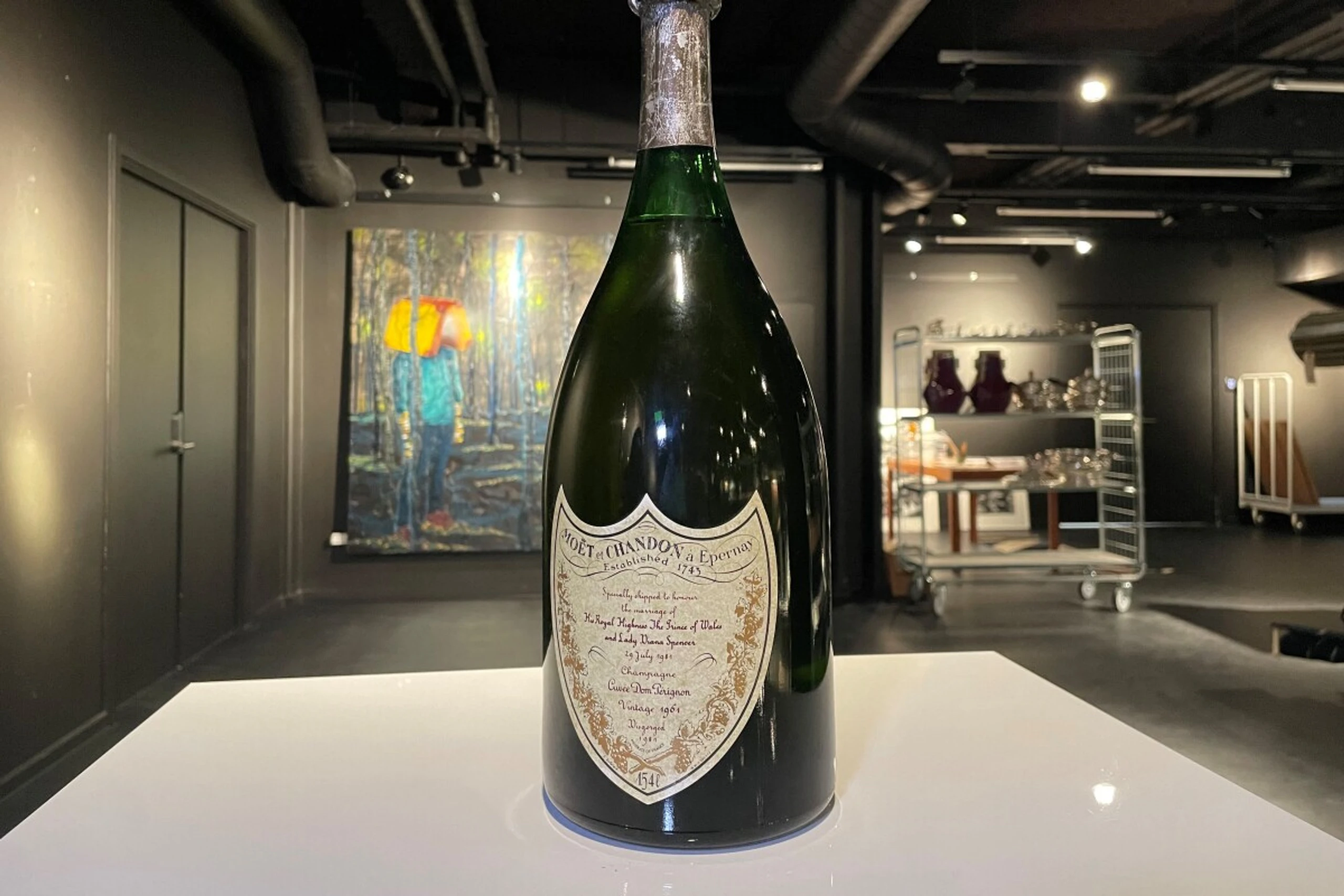Wir leben in einer postheroischen Gesellschaft, die ihre Kinder zu Ängstlichkeit und Unselbständigkeit erzieht. Abenteuer sind in dieser Vollkaskomentalität nicht nur nicht erwünscht, sondern eigentlich sogar verboten.
Abenteurer waren schon mal angesehener als in unserer Vollkaskogesellschaft. In einer Zeit, in der viele Zeitgenossen zwei Mal überlegen, ob sie ein Sommerfest ohne Wetterversicherung riskieren sollen, ist jemand, der mit einem Kohlentransportschiffin den Südpazifik fährt, wie der schottische Ausnahmenavigator James Cook, kein Held, sondern ein Patient.
Von Ernst Jünger, der vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen im Ersten Weltkrieg („In Stahlgewittern“) das Abenteuer mit der Todesnähe in Verbindung brachte, bis zur „Generation Angst“, wie sie der amerikanische Sozialpsychologe Jonathan Haidt in seinem, man kann es nicht anders sagen, epochalen Buch „The Anxious Generation“ beschreibt, sind es hundert Jahre und eine Ewigkeit.
Wie sollen aus Kindern, denen gewissermaßen polizeilich verboten wird, von einem Klettergerüst zu fallen, jemals Erwachsene werden?
Auch wenn man Ernst Jüngers Heroisierung des Kriegsgrauens nicht teilt, muss einem die Ängstlichkeit der zeitgenössischen Jugend, die eine unmittelbare Folge des fast schon absurden Sicherheitsdenkens der postheroischen Elterngeneration ist, Sorgen bereiten: Wie sollen aus Kindern, denen gewissermaßen polizeilich verboten wird, von einem Klettergerüst zu fallen, jemals Erwachsene werden? Was soll überhaupt aus einer Welt werden, in der die Grenzüberschreitung nicht das Maß des Menschlichen, sondern prinzipiell ein Delikt ist?
Gut und Böse
Wie schwer wir Zeitgenossen uns mit dem Begriff des Abenteuers tun, hat sich vergangene Woche auch beim „Philosophicum“ in Lech am Arlberg gezeigt. Vielleicht lag es auch am Untertitel „Lob des Unverfügbaren“, weil der die begriffliche und emotionale Büchse der Pandora öffnet, aus der dann gleich einmal Gott und Hartmut Rosa entweichen und die Menschen in Aufregung und Verzückung versetzen, was das Denken bekanntlich nicht erleichtert. Ganz unten in der echten Büchse der Pandora, die eigentlich ein Krug gewesen ist, lag, gewissermaßen als Grundlage aller Übel, die Hoffnung, aber das ist eine andere Geschichte.
Zu den Grundthesen, die in Lech vorgetragen wurden, gehörte, dass das Abenteuer zwei Voraussetzungen erfüllen muss, damit wir mit Fug und Recht von einem solchen sprechen können: Es muss gut ausgehen und es muss davon erzählt werden, was in früheren Zeiten ungefähr das gleiche gewesen ist, weil jemand von seinen Abenteuern ja nur erzählen konnte, wenn er sie bestanden hatte.
Dass kaum jemand den Umstand erwähnt hat, dass auch in dieser Hinsicht die Digitalisierung unserer Kommunikation einen substanziellen Unterschied hervorgebracht hat – erzählt wird fast ausschließlich in Echtzeit, ein Abenteuer ist genau dann zu Ende, wenn der Akku aus ist –, deutet darauf hin, dass die bekannteren Philosophen und Geisteswissenschafter des deutschsprachigen Raumes nicht zu den sogenannten „Digital Natives“ gehören. Ich halte die Abstinenz gegenüber den Sozialen Medien für einen wichtigen Akt des Widerstands gegen die Weltdummheit, aber es kann nicht schaden, ungefähr zu wissen, wie sie funktionieren.
Endemisch gewordene Ängstlichkeit
Genauso wichtig wie die endemisch gewordene Ängstlichkeit ist für den Ansehensverlust des Abenteuers und des Abenteurers die umfassende Moralisierung jeder öffentlichen Debatte. Entdeckung und Kolonisation sind Synonyme geworden, und so sehr das im historischen Rückblick seine Berechtigung haben mag, so katastrophal ist auch in diesem Fall die Ausblendung des historischen Kontexts für ein angemessenes Verständnis der Ereignisse.
Wer das Agieren von Menschen vor mehreren hundert Jahren an den ethisch-moralischen Standards der Gegenwart misst, hat nichts verstanden, und man muss davon ausgehen, dass so jemand auch nicht dazu in der Lage ist, zeitgenössisches Geschehen sinnerfassend zu beschreiben.
Das beste aktuelle Beispiel dafür ist die absurde Verurteilung und Bekämpfung Israels unter dem „antikolonialen“ Paradigma. Das führt dann dazu, dass der aktuelle syrische Machthaber, der noch vor nicht so langer Zeit stolz abgeschnittene Menschenköpfe in die Kamera gehalten hat, vom französischen Pseudo-Napoleon mit herzlicher Umarmung im Élysée-Palast empfangen wird, während man den israelischen Ministerpräsidenten per internationalem Haftbefehl als Kriegsverbrecher sucht.
Die wahren Abenteuer, sang André Heller, sind im Kopf
Was uns direkt zur Kategorie des „politischen Abenteurers“ führt, der, seit es den Begriff gibt, selten wohlgelitten war. Man versteht darunter einen Glücksritter, der die Politik zur Maximierung seines eigenen Vorteils in Sachen Geld und Macht ausnützt, ohne sich um die Anliegen und Interessen der Bürger, in deren Namen und auf deren Rechnung er agiert, zu kümmern. Wenn man sich die beiden jüngsten Beispiele für politisches Abenteurertum in Lateinamerika ansieht: Während der amtierende argentinische Präsident Javier Milei und sein libertäres Abenteuer von so gut wie allen europäischen Medien als kaum noch demokratisches, sondern eher kriminelles Experiment rezipiert werden, feierte man vor noch nicht so langer Zeit den Neostalinismus eines Hugo Chávez, der das erdölreiche Venezuela in Diktatur und Armut gestürzt hat, als globale Heilsfigur.
Die wahren Abenteuer, sang André Heller, sind im Kopf. Der Stoiker Epiktet meinte, dass die Einbildungen der Abenteuer im Kopf seien. Der zeitgenössische Moralist weiß davon nichts, denn dicke Bretter vor dem Kopf erlauben nicht einmal die Einbildung eines Abenteuers.
Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: redaktion@news.at
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 40/2025 erschienen.