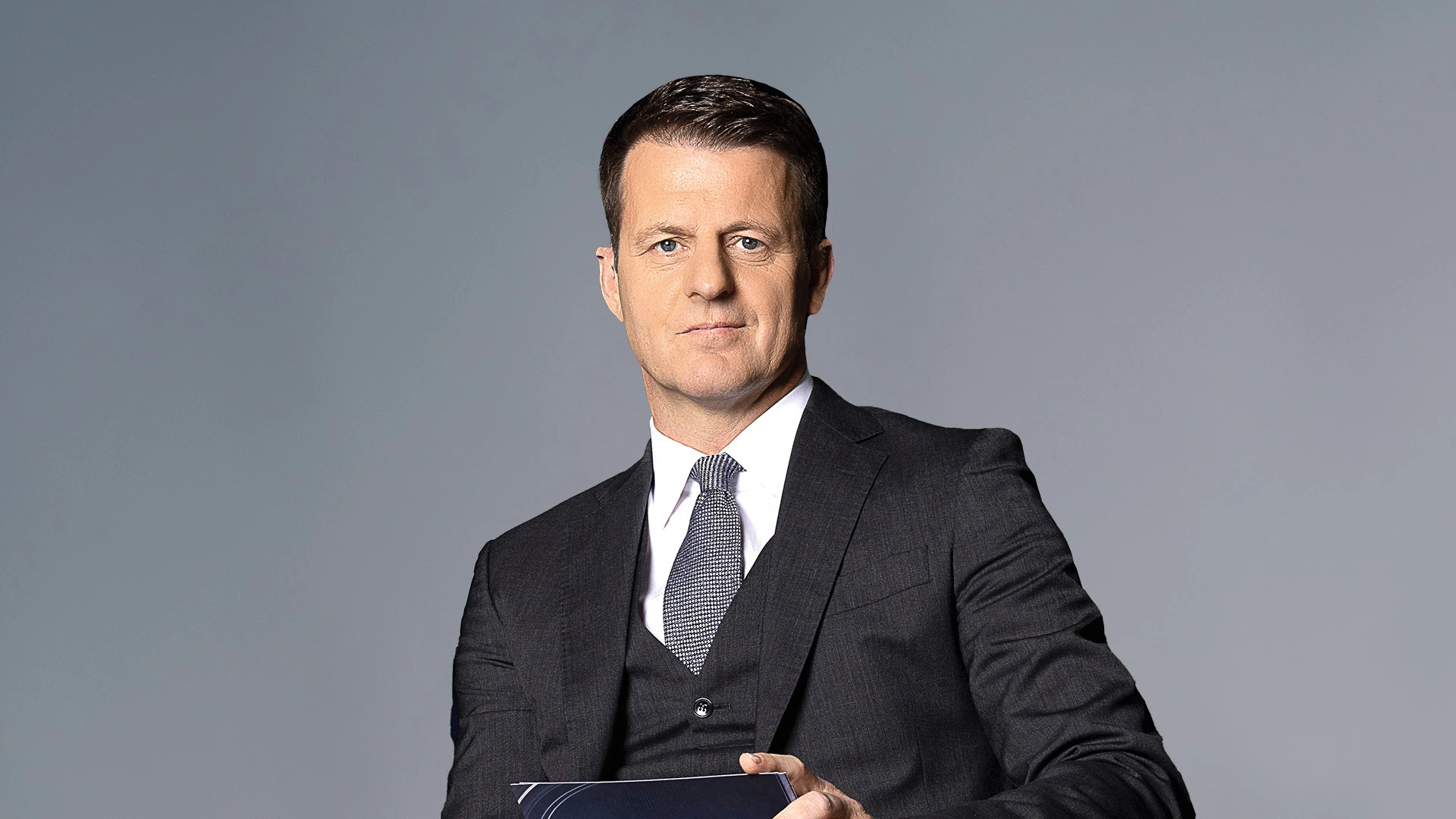Immer mehr Menschen fühlen sich einsam - und das in Zeiten permanenter Verbundenheit. Einsamkeit wird zur Volkskrankheit, besonders bei jungen Menschen. Warum wir die digitale Gegenwart jetzt kritisch hinterfragen sollten
Die Menschen werden immer einsamer. Nicht nur die älteren Semester – sondern vor allem die Jungen. Als Angehörige der „Digital Natives“, also jener Generation, die mit Handy, Computer und Internet aufgewachsen ist, möchte ich die nächsten Zeilen ganz selbstkritisch nutzen, um mich über den problematisch gewordenen digitalen Medienkonsum zu echauffieren. Und auch über die Politik, die es zunehmend verabsäumt, Menschen vor Digitalkonzernen – und vor sich selbst – zu schützen.
Komplette Isolation
Kaum ein Tag vergeht, ohne dass neue Studien erscheinen, die Einsamkeit und soziale Medien in Zusammenhang bringen. Die Ergebnisse sind alarmierend: Laut Bertelsmann fühlen sich 46 Prozent der 16- bis 30-Jährigen einsam. Die WHO spricht von jedem vierten Jugendlichen, der sozial isoliert ist. Und das in Zeiten von „Social Media“, einer Zeit der Hyperkonnektivität, der ultimativen, ständigen Erreichbarkeit.
Wo ist das Soziale in den Social Media geblieben? Lassen Digitalkonzerne unseren Sozialmuskeln etwa komplett verkümmern, schleichend aber nachhaltig? Während der Pandemie waren Kontakte problematisiert, ihre Abwesenheit konnten wir dank Social Media überbrücken. Doch danach? Viele mussten sich erst wieder an andere Menschen gewöhnen. Manche isolierten sich so sehr, dass Forscher vom „Cave- bzw. Höhlen-Syndrom“ sprachen.
Netflix statt soziale Interaktion
Die steigende Einsamkeit, einst vor allem in hoch technologisierten Ländern wie Japan oder China ein Thema, ist längst bei uns angekommen. Heute muss man das Haus nicht mehr verlassen, um sich verbunden zu fühlen: Ein Emoji im Gruppenchat reicht scheinbar aus – aber eben nur scheinbar.
Wir sind sozial bequemer geworden und überlassen Digitalplattformen das Feld oft ein bisschen zu unkritisch
Nach der Arbeit noch mit Freunden auf ein Bier? Für viele selten möglich, einerseits, weil ein Bier selbst in Wien schon an der Sechs-Euro-Grenze kratzt, andererseits, weil Netflix nach einem harten Arbeitstag oft verführerischer klingt. Wir sind sozial bequemer geworden und überlassen den Digitalplattformen oft ein bisschen zu unkritisch das Feld: Ständig verpassen wir die wichtigen Momente unseres Lebens, betrachten diese nur durch die Linse unserer Handykamera und fragen uns dann, warum wir uns zunehmend einsam fühlen.
Als Teilzeit arbeitende Mutter (keine Lifestyle-Teilzeit, ich verspreche es!), verbringe ich viel Zeit mit meiner kleinen Tochter auf dem Spielplatz und staune, wie viele Menschen lieber ihre Handybildschirme anstarren, anstatt ihre Kinder für das Klettergerüst zu befähigen. Wissen wir in 20 Jahren wirklich noch, auf welchen Webseiten wir gesurft sind, als unsere Kinder ihre ersten Balancierversuche gemacht haben? Sehr unwahrscheinlich. Werden sie sich an unsere ausdruckslosen Gesichter erinnern, während wir sinnlos Content konsumierten? Sehr wahrscheinlich.
Mut zur Selbstreflexion
Das Thema hat auch eine politische Komponente. Wäre Donald Trump ohne soziale Medien jemals so erfolgreich geworden? Wohl kaum. Könnte Elon Musk ohne sie seine Halbwahrheiten verbreiten? Kaum ein unabhängiges Medium würde ihn langfristig zitieren. Rechtskonservative Influencer instrumentalisieren Themen wie die Einsamkeit junger Männer und suggerieren, es gäbe einfache Antworten auf komplexe Probleme. Zu viel Bedeutung sollte man ihnen dennoch nicht beimessen – Populisten sind letztlich nur Symptom.
Ich arbeite täglich mit sozialen Medien und weiß, dass sie durchaus vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung bieten – sofern man sie denn auch dazu nutzt. Nur leider waren soziale Medien nie sozial, allerhöchstens sind sie Infotainment-Plattformen. Echten, zwischenmenschlichen Austausch können sie nicht ersetzen.
Dritte Räume
Was wirklich fehlt, sind „dritte Räume“. Nicht digital, sondern analog: Der Soziologe Ray Oldenburg prägte diesen Begriff 1989 und meinte damit Orte, die Identität, soziale Integration und Zugehörigkeit fördern. „Dritte Räume“ sind, in Abgrenzung zum eigenen Zuhause oder dem Arbeitsplatz, öffentliche Orte – Bücherläden, Kaffeehäuser oder Bars – an denen Menschen zusammenkommen und sich austauschen, Kultur, Verbundenheit, Gemeinschaft (und im weiteren Sinne: Demokratie!) leben.
Solche Räume fehlen zunehmend, vor allem jungen Menschen: Bars sind oft unleistbar, viele Buchhandlungen kämpfen ums Überleben. Höchste Zeit, neue, sichere Orte des Zusammenkommens zu schaffen, um die Vorzüge von Gemeinschaft und Miteinander wieder erleb- und erfahrbar zu machen.
Das ruft auch die Politik auf den Plan: Vor allem die Teuerung zwingt viele dazu, einmal mehr zu Hause zu bleiben, anstatt sich zu verabreden. Vereinsamung wird zum Politikum: Für alle relevanten Bereiche unseres Lebens brauchen wir andere Menschen. Daran wird auch Silicon Valley nichts ändern.
Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: edhofer.sinah@news.at
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 42/25 erschienen.