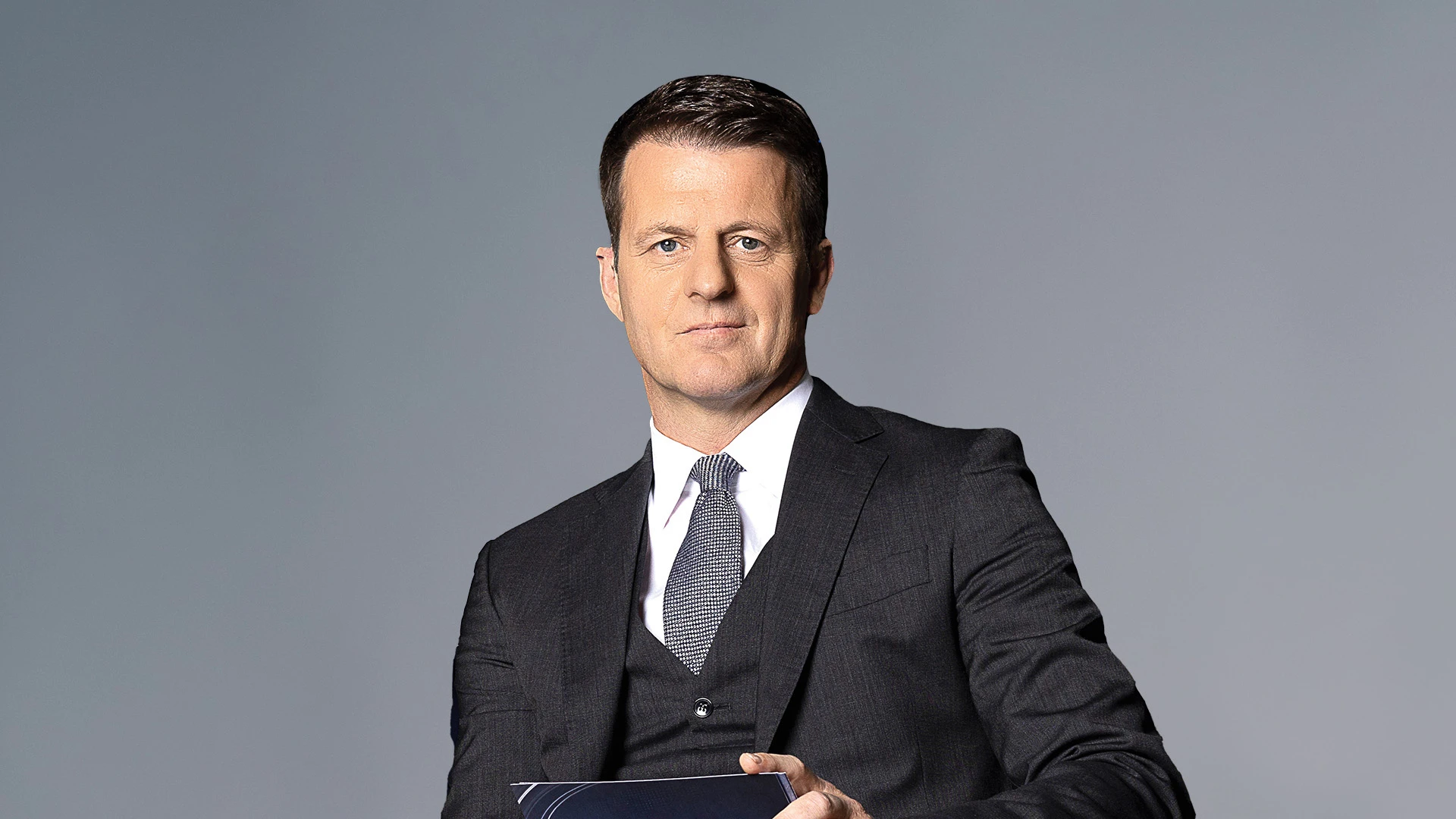Unsere Zeit ist laut, aber nicht mehr dialogfähig. Dabei entsteht Veränderung erst im Streit der Ideen. Die feministische Aktivistin Inna Shevchenko erkundete für ihren Film „Girls & Gods“ die Funktion der Religion als Werkzeug in patriarchalen Strukturen. Es sind die unbehaglichen Debatten, die gesellschaftlichen Fortschritt ermöglichen, sagt sie, und erklärt, woran sie als Atheistin glaubt.
Ist Religion für den Feminismus zwangsläufig ein Hindernis?
Zunächst möchte ich klarstellen: Eine Person kann Feministin und gläubig sein. Ich habe gläubige Frauen getroffen, die mutig innerhalb ihrer religiösen Traditionen für Gleichberechtigung kämpfen. Doch Feminismus als gesellschaftlicher und politischer Kampf und Religion als organisierte Ideologie sind für mich unvereinbar. „Religiöser Feminismus“ wirkt wie ein Versuch, patriarchale Traditionen und den Sexismus, den sie beinhalten, reinzuwaschen.
Spannend finde ich die umgekehrte Perspektive: Was kann Feminismus für Religionen tun? Die Perspektive habe ich von katholischen Priesterinnen, die für Gleichberechtigung innerhalb der Kirche kämpfen. Sie tragen feministische Ideen in ihre Institutionen, um die Entrechtung von Frauen aufzubrechen. „Girls & Gods“ ist keine Abrechnung mit Religion, sondern eine Kritik an Machtstrukturen, die Frauen ausgrenzen.
Welche Rolle spielt Religion im patriarchalen System?
Historisch haben die monotheistischen Religionen Frauen immer systematisch ausgeschlossen. „Disqualifiziert“ ist eigentlich das treffendste Wort: Wir sind von Orten der Macht ausgeschlossen worden und in den Schriften auf Rollen reduziert – Mutter, Tochter, Ehefrau. Unsere Körper sind entwertet worden, als heilig oder sündig beschrieben, selten als selbstbestimmt. Natürlich waren da Fortschritte, durch Reformation oder Bildung. Doch diese Freiräume werden immer wieder eingeschränkt. Auch heute, 2025, in Europa.
Können Sie diese Einschränkungen benennen, was ist aktuell problematisch?
Gestern habe ich die Architektur der Karlskirche bewundert und dann … dort hängt ein großes Werbeplakat für den „Marsch fürs Leben“ (eine jährlich stattfindende, von konservativen und kirchennahen Gruppen organisierte Demonstration gegen Abtreibung, Anm.). Ein Symbol dafür, dass Kirchen bis heute meinen, über weibliche Körper, ihre Lebensentscheidungen, ihre Autonomie bestimmen zu dürfen. Und weltweit sind die repressivsten Regime oft religiös grundiert: Im Iran riskieren Frauen Gefängnis oder sogar ihr Leben, wenn sie das Kopftuch ablegen. In Afghanistan ist Frauen die Teilhabe am öffentlichen Leben vollständig untersagt – ihre Existenz ist ab der Kindheit auf den privaten Raum reduziert.
Auch in Europa verbinden sich Religion und Politik gegen Frauen: In Polen hat die katholische Kirche die konservative Regierung unterstützt, die das Abtreibungsrecht nahezu vollständig abgeschafft hat. Es gab riesige Proteste, doch die Stimmen der Frauen sind ignoriert worden. Ich konstruiere hier kein Feindbild. Religiöse Institutionen haben diese Rolle selbst eingenommen.
Das Muster ist immer gleich: Sobald religiöse Institutionen politisch Einfluss erhalten, wenden sie sich gegen Frauen
Ich habe zur Zeit des diktatorischen Regimes von Viktor Janukowitsch – eine Kreml-Marionette – in der Ukraine als Aktivistin begonnen. Eine der mächtigsten Institutionen, die uns damals verfolgt hat, war die russisch-orthodoxe Kirche. Sie habt offen unsere Verhaftung gefordert. Dasselbe hat Pussy Riot in Russland erlebt. Wir haben die Kirche nicht zu unserem Gegner erklärt – sie hat diese Rolle selbst eingenommen. Das Muster ist immer gleich: Sobald religiöse Institutionen politisch Einfluss erhalten, wenden sie sich gegen Frauen. Das ist unsere Realität.
Haben Sie sich je nach dem Warum gefragt, nach den Wurzeln dieser Entwicklung?
Alle monotheistischen Religionen sind im Kern politische Ideologien. Sie wurden so verfasst, gelehrt und strukturiert, dass sie Macht sichern – männliche Macht, auf Kosten der Frauen. Deshalb finden wir Religion fast immer an der Seite autoritärer Regime. Man sieht es weltweit, auch in den USA: Mit Trumps Wahlsieg kam sofort eine Welle neuer Abtreibungsverbote. Religionen sind ein Werkzeug der Macht.
Welche Rolle hat Religion und Glauben in Ihrer Kindheit gespielt? Sind Sie religiös erzogen worden?
Sie war Teil des Alltags, ich bin in einer orthodox geprägten Familie aufgewachsen, mit Festen, Ritualen, Kirchenliedern. Es war eine schöne Erfahrung: gemeinsames Singen, die Wärme der Familie, und vor allem meine Großmutter, eine tiefgläubige Frau, die mit ihrer Spiritualität viel Gutes getan hat. Diese Seite der Religion habe ich als Kind sehr geschätzt.
Als Jugendliche habe ich die Kehrseite erlebt: Plötzlich hieß es, ich sei während der Menstruation „unrein“ und dürfe die Kirche nicht betreten, ich wurde ausgeschlossen. Frauen sollten still, bescheiden, angepasst sein – selbst wenn es nicht ihrem Wesen entsprach. Manche Frauen fühlen sich damit wohl, das ist legitim, aber manche eben nicht. Ich habe es als etwas erlebt, das meine Freiheit beschnitten hat. Mir ist klar geworden, dass Religion ein zentrales Mittel der Unterdrückung von Frauen ist.


Der Film
In „Girls & Gods“ untersucht Inna Shevchenko – Regie: Verena Soltiz, Arash T. Riahi – in zahlreichen Gespräche die komplexe Beziehung zwischen Religion und Frauenrechten. Sie trifft Frauen verschiedener Konfessionen, darunter die weibliche Imamin Seyran Ateş, Schweizer Theologinnen, die eine Frauenbibel verfasst haben, die katholische Pro-Choice-Bewegung in New York, die römisch-katholische Priesterinnenbewegung in Linz und zeigt Kunst wie „Lingua – sprachlos“ von Ina Loitzl im Klagenfurter Dom (Foto oben).
In Ihrem Film kommen Frauen mit radikal widersprüchlichen Meinungen zu Wort. Warum?
Weil es gefährlich ist, Menschen in homogene Gruppen, in Identitätsgruppen zu pressen. „Die Musliminnen“, „die Feministinnen“ – das ist politisch bequem und gefährlich. Es gibt zwei Frauen im Film, die das Kopftuch verteidigen – aber aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. Ihre Argumente unterscheiden sich so sehr, dass eine von ihnen mehr mit mir gemeinsam hat als mit der anderen. Erfahrungen, Motivationen und Entscheidungen sind vielfältig. Erst in dieser Pluralität erkennt man, dass nichts schwarz-weiß ist. Und doch wird etwas Universelles sichtbar: Alle Frauen, egal, aus welcher Richtung sie argumentieren, kämpfen für Anerkennung als eigenständige Subjekte.
Ob liberal oder konservativ – es geht allen darum, selbst entscheiden zu können. Um diese Einigkeit bei aller Andersartigkeit zu erkennen, braucht es Debatten, auch wenn sie unbequem sind. Wir verlieren uns im Feminismus zu oft in Abgrenzungen voneinander und übersehen das gemeinsame Ziel der Selbstbestimmung. Autoritäre Kräfte machen es anders: Sie wissen, wie man sich für gemeinsame Ziele zusammenschließt. Progressive Bewegungen müssen dasselbe lernen.
Sie zeigen, wie sich Menschen nach hitzigen Debatten über Grundsätzliches umarmen. Das sind fast surreal wirkende Bilder. Ging es Ihnen dabei um die Kraft des Zuhörens?
Das ist genau meine Kritik an unserer Gesellschaft: Wir haben verlernt, zuzuhören und zu debattieren. Stattdessen laufen wir weg und suchen nur noch „Safe Spaces“ unter Gleichgesinnten. Doch diese Räume machen die Gesellschaft nicht sicherer – im Gegenteil: Sie verhindern Begegnung und Austausch. Debatten sind kein Krieg zwischen Menschen, sondern ein Ringen um Ideen. Ich kann jemanden respektieren, ja mögen, und gleichzeitig seine Argumente ablehnen. Denn Überzeugungen sind veränderbar und Menschen sind mehr als ihre Ansichten. Genau das wollte ich zeigen: Diskussionen können unbequem, aber zugleich produktiv und befreiend sein. Wir sollten wieder lernen, uns im Unbehagen wohlzufühlen – nur so bleibt gesellschaftlicher Fortschritt möglich.
Inwieweit geht es bei allem Zuhören dennoch darum, Meinungen zu ändern, um das System zu ändern? Wollen das nicht auch die römisch-katholischen Priesterinnen*, mit denen Sie in Oberösterreich und in den USA gesprochen haben?
Sie würden es selbst nicht so nennen, aber was diese Frauen tun, ist revolutionär. Ihre Argumentation lautet: Die Dogmen stammen aus einer bestimmten Zeit, viele Gläubige sehen das längst anders. Die Priesterinnen protestieren nicht laut – mit nacktem Oberkörper auf öffentlichen Plätzen, wie ich es getan habe – sie bleiben in ihren Gemeinden, beten, singen.
Trotzdem überschreiten sie Grenzen: Eine Frau, die den Altar betritt, widersetzt sich einem jahrhundertealten Verbot. Wie ich gehen sie an Orte, die ihnen verboten wurden. Es geht ihnen darum, dass Frauen dieselben Dinge tun dürfen wie Männer. Aber in Wahrheit verändert das die Institution grundlegend. Wenn Frauen predigen, Texte auslegen, sakrale Rollen übernehmen, dann rüttelt das an der Basis der anti-femininen Strukturen. Der Vatikan hat sie exkommuniziert, aber diese Frauen machen still weiter – und die Gemeinden folgen ihnen. Das ist eine tiefgreifende Revolution, die sind echte Punks!
Die römisch-katholischen Priesterinnen
Die römisch-katholischen Priesterinnen im Film zählen zum Teil zu den „Donau-Sieben“, sieben Frauen, die 2002 auf einem Schiff zwischen Passau und Linz zu Priesterinnen geweiht wurden. Daraus entstand die internationale Organisation Association of Roman Catholic Women Priests mit Priesterinnen in
Die Möglichkeit zur freien Entscheidung und Religion schließen einander aus, sagen Sie. Warum?
Weil Wahlfreiheit im Kern ein säkulares Konzept ist – Religion setzt Grenzen. Jede Entscheidung, die außerhalb der heiligen Schriften liegt, gilt als Blasphemie. Freiheit zu wählen, bedeutet in religiösen Strukturen fast immer, „falsch“ zu wählen – besonders für Frauen. Das zeigt sich am Kopftuch. Ja, es kann eine bewusste Entscheidung sein für ein traditionelles, konservatives Leben. Viele junge Frauen sagen „Es ist meine Wahl“ und hier beginnt die Grauzone in Debatten mit Musliminnen, denn diese Wahl ist durch Familie und Gemeinschaft massiv vorgeprägt. Wer sich dagegen entscheidet, zahlt einen hohen Preis bis hin zum Ausschluss aus der eigenen Familie.
Eine Ex-Muslima aus London hat mir erzählt: Als sie mit Mitte 20 das Kopftuch abgelegt hat, warf ihre Familie sie aus dem Haus und sie endete auf der Straße. Wenn wir über „Wahlfreiheit“ reden, müssen wir die Bedingungen betrachten, unter denen Entscheidungen entstehen. Denn oft wählen Frauen nicht zwischen Freiheit und Tradition – sondern zwischen Anpassung oder Ausgrenzung.
Haben Sie so etwas wie einen Glauben?
Natürlich. Jeder Aktivist glaubt an etwas, sonst würde er nicht kämpfen. Mein Glaube heißt Freiheit. Deshalb höre ich mir auch Stimmen an, die mir völlig entgegengesetzt sind. Ihre Freiheit, ihre Überzeugungen zu äußern, ist genauso wichtig wie meine. Aber ich glaube nicht an imaginäre Autoritäten, nicht an religiöse Instanzen. Ich glaube an das Individuum, an die Autorität jedes Menschen. Für mich ist das eine sehr starke Form von Glauben. Deshalb irritiert mich die Vorstellung, Atheisten würden nicht glauben.
Ihr Aktivismus begann mit radikaler Sichtbarkeit, provokanten Aktionen. Hat sich Ihr Weg seitdem verändert?
Natürlich. Am Anfang musste ich mir Gehör verschaffen – als junge Frau aus der Ukraine war das fast unmöglich. Mit schockierender Ästhetik haben wir Aufmerksamkeit erzwungen. Es ist wie ein Weg in Stufen: Zuerst musst du laut sein, deine Botschaft hinausschreien. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem du über den Slogan hinauswillst. Denn ein Slogan schafft Aufmerksamkeit für Sekunden, eine Frage aber eröffnet einen langen Prozess des Nachdenkens, der Diskussion, der Reflexion – in der Gesellschaft und in dir selbst.
Sobald man sich ganz seinem eigenen Dogma unterwirft, ist kein Fortschritt mehr möglich – weder für die Gesellschaft noch für das Individuum
Ich will keine fertigen Antworten anbieten. Unsere Gesellschaft ist ohnehin von dogmatischen Gewissheiten überladen. Alle glauben die Antwort zu haben, doch keiner hat sie. Das ist typisch für unsere polarisierte Gesellschaft. Für mich als Aktivistin war diese Reise auch eine Übung, selbst weniger dogmatisch zu werden. Sobald man sich ganz seinem eigenen Dogma unterwirft, ist kein Fortschritt mehr möglich – weder für die Gesellschaft noch für das Individuum.
Sie haben 2015 einen Anschlag auf eine Podiumsdiskussion in Kopenhagen überlebt. Wie bedroht fühlen Sie sich durch Ihre Arbeit als feministische Aktivistin?
Ich bin 35. Ich wurde Dutzende Male verhaftet, vom russischen KGB in einen Wald verschleppt und misshandelt, auf der Straße geschlagen, mit dem Tod bedroht. Ich habe ein Terrorattentat überlebt. Meine Biografie ist voller Gewalt und Drohungen. Aber ganz ehrlich: Wer ist heute wirklich sicher? Die Vorstellung von Sicherheit ist eine Illusion. Mächte auf allen Ebenen – geopolitisch wie im Alltag – arbeiten daran, uns Schutz und Stabilität zu nehmen.
Natürlich habe ich mein Leben an diese Gefahren angepasst. Doch entscheidend ist: Ich wäre verletzlicher, wenn ich schweigen würde. Schweigen bedeutet Aufgabe. Deshalb sage ich: Ich fühle mich unsicherer, wenn ich aufhöre zu kämpfen. Viele fragen, woher ich die Inspiration nehme, weiterzumachen. An den meisten Tagen fehlt sie mir. Aber eine Frage treibt mich an: Was passiert, wenn wir aufhören? Und die Antwort erschreckt mich zutiefst. Genau dann, wenn wir verstummen, beginnt die wirkliche Unsicherheit.


Femen-Aktion 2017. Nackte Proteste in Frankreich schafften Aufmerksamkeit. Heute ruft Inna Shevchenko durch große Fragen zum Nachdenken auf.
© Bild: imago/ZUMA PressUnser aller Unsicherheit steigt gerade durch weltweit zunehmende Kriege – bedrohen Kriege Frauen stärker als Männer?
Davon bin ich überzeugt. Kriege sind meist von Männern gewollt, doch Frauen zahlen den höheren Preis. Heute verteidigen viele Ukrainerinnen ihre Heimat an der Front, sie tragen Waffen, bedienen Drohnen. Aber die Folgen des Kriegs betreffen Frauen unverhältnismäßig stark. Russland setzt sexualisierte Gewalt systematisch als Kriegswaffe ein. Schon in den ersten Wochen der Besatzung von Cherson, wo meine Mutter und Schwester damals gelebt haben, gab es Vergewaltigungskampagnen. In Butscha, Irpin und anderen Orten wurden Frauen misshandelt, oft vor den Augen ihrer Angehörigen.
Das ist keine „Begleiterscheinung“ von Krieg, sondern eine gezielte Strategie der Zerstörung. Zugleich erleben Frauen an der Front massives Stigma. Männer mit Waffen gelten als Helden. Frauen mit Waffen werden von ihren Familien als unverantwortlich beschimpft – als Mütter, die ihre Kinder im Stich lassen, oder als Töchter, die sich um die Eltern kümmern sollten. So bleibt ein doppelter Schmerz: Frauen kämpfen und riskieren ihr Leben und gleichzeitig wird ihnen Anerkennung verweigert. Selbst dort, wo sie Gleiches leisten, sind sie nicht gleich angesehen.

Steckbrief
Inna Shevchenko
Inna Shevchenko kam 1990 in Cherson zur Welt und ist eine der bekanntesten feministischen Aktivistinnen Europas. Sie studierte Journalistik und trat ab 2009 als Femen-Aktivistin mit spektakulären, oft halbnackten Protestaktionen gegen Sexismus, religiösen Fundamentalismus und autoritäre Regime an. Nach dramatischen Repressionen in der Ukraine floh sie nach Paris, wo sie ihre Arbeit fortsetzt.
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 41/2025 erschienen.