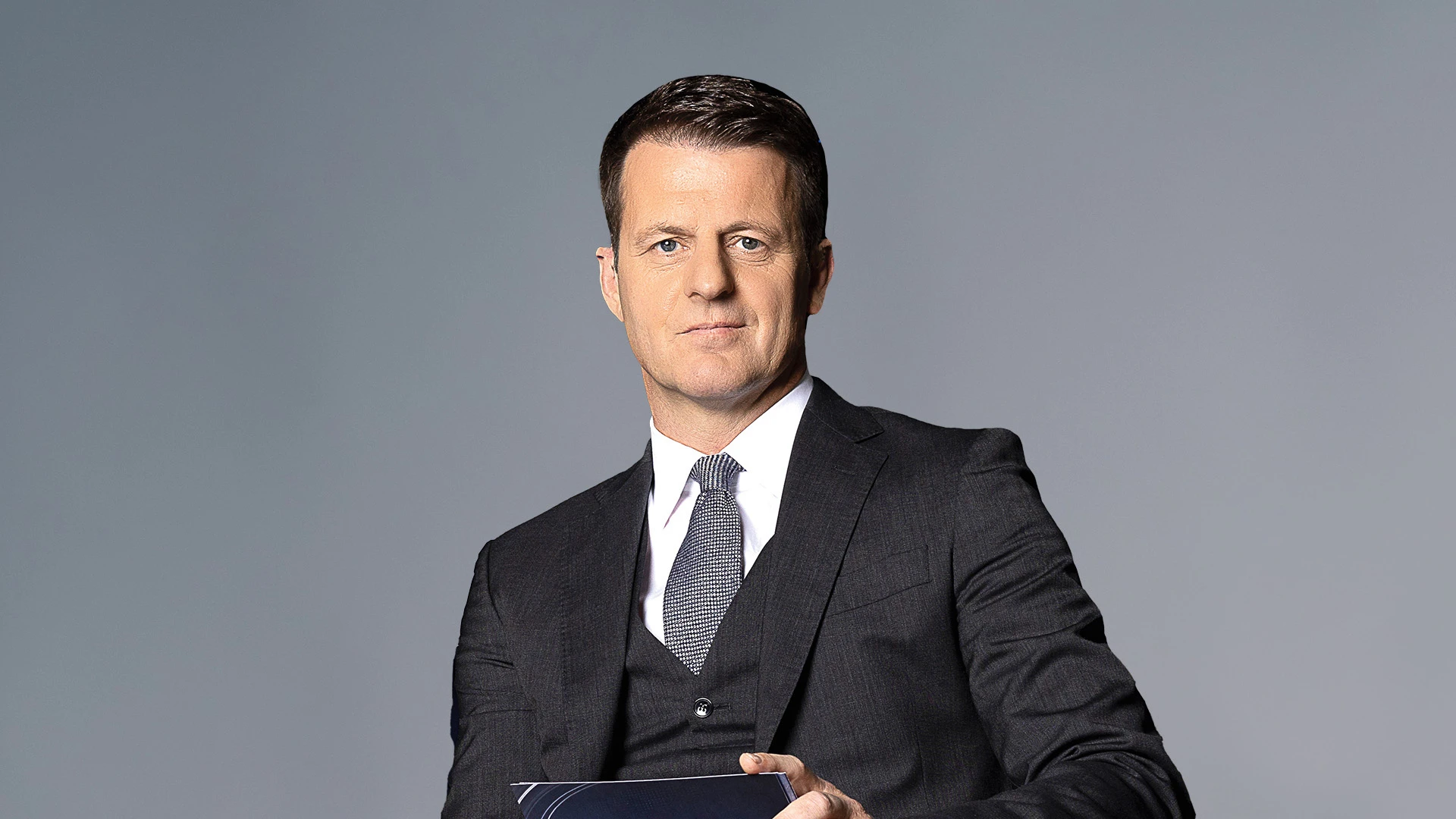Wenig hält sich so hartnäckig wie die Unterteilung der Gesellschaft in Klassen. Warum wir alle uns in einem täglichen Wettbewerb um unseren Status befinden, ob man dabei tricksen kann und an welchen Signalen man „die Oben“ und „die Unten“ erkennt, beschreibt der deutsche Philosoph Hanno Sauer.
von
Die klassenlose Gesellschaft klingt gut – allerdings liegt es in der Natur der Menschen, sich von anderen abzuheben und zu unterscheiden. Gar nicht so sehr durch Reichtum und Vermögen, sondern viel mehr durch versteckte und offene Signale, die dem Gegenüber den eigenen Status signalisieren sollen.
Der deutsche Philosoph Hanno Sauer hat ein Buch darüber geschrieben, warum sich das „Oben“ und „Unten“ so hartnäckig halten. Und er erklärt, wie wir Menschen und ihre Statusspielchen im Alltag lesen können. Beispiel? Das Louis-Vuitton-Täschchen, das so manche gerne spazieren trägt. Laut Sauer ein Accessoire der Mittelschicht, die gerne zeigt, sich das Ding leisten zu können, während man eine Klasse darüber, die Tasche nicht einmal mehr mit der Kneifzange angreifen würde, weil man sich ja von denen da unten abgrenzen muss. Vertreterinnen alten Geldes wiederum können dieses schon wieder lässig in die Louis-Vuitton-Tasche füllen. Vintage – man hat sie nämlich geerbt.
Eine weitere Unterscheidung laut Sauer: Untere Schichten definieren sich über Geld, die Mittelschicht über Bildung, die Oberschicht weiß, dass beides nur mehr bedingt für ihren Status spricht. Bzw. dass Distinktion auch einen finanziellen Absturz wie beim sprichwörtlich verarmten Adel überleben kann. Auch hier geht es um Signale: Man sammelt „schwierige“ Kunst, oder tut zumindest so, als würde man sie verstehen. Man hat erlesene moralische Ansprüche. Oder (wäre man Brite) einen feinen Oxford-Akzent. Die Sprache der Oberklasse sei nämlich ein schwer zu fälschendes Signal, so Sauer. News bat den an der Uni Utrecht lehrenden Philosophieprofessor zum Gespräch:
Es ist jetzt 11 Uhr vormittags: Wie viele Statussignale haben Sie heute bereits ausgesendet?
Ich bin gefragt worden, ob ich an einer Promotionsverteidigung an der Uni teilnehme, habe Drittmittelanträge für das niederländische Uni-System begutachtet – das sind Dinge, für die man nur angefragt wird, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat. Ich habe etwas zu einem Film von Thomas Anderson getweetet – kulturelle Inhalte sind natürlich immer Statussignale.
In der Tat ist es kaum möglich, sich in der Gesellschaft zu bewegen, ohne Statussignale zu senden. Auch dieses Interview mit Ihnen zu führen, zeigt die eigene Position in einer sozioökonomischen und soziokulturellen Hackordnung an.
Der Mensch strebt nach Unterscheidung, seit er sesshaft geworden ist und Besitz anhäuft. Alle Versuche einer klassenlosen Gesellschaft sind gescheitert. Was macht Klasse so stabil?
Den Versuch, sich voneinander abzuheben und an der Spitze der eigenen Gruppe zu stehen, gab es bei den Menschen schon immer. Den gibt es auch bei anderen Viechern. Allerdings war es in unserer frühen Geschichte, als der Mensch in sehr kleinen Gruppen lebte, möglich, Ausbrüche aus dem Gleichheitsmorast abzuwehren.
Der Mechanismus hat zu versagen begonnen, als wir sesshaft und menschliche Gruppen immer größer wurden. Da gelang es kleinen Grüppchen, sich zur Elite zu erklären und sich einen unverhältnismäßigen Anteil an gesellschaftlichem Reichtum unter den Nagel zu reißen. Der Rest der Gruppe wurde zu groß, um sich dagegen zu organisieren.
Auf den Einzelnen heruntergebrochen: Jeder von uns ist täglich in Statuswettbewerbe verstrickt, weil er den Status in seiner eigenen Gruppe erhalten oder verbessern will?
Es ist ein permanenter Kampf um Distinktion, aber auch eine Balance aus Abgrenzung und Konformität. Es gibt Hochglanzmagazine für Interior Design und Möbel – von einfach bis intellektuell. Die haben die Funktion, den Leuten zu erklären, wie sie sich mit ihrer Einrichtung von anderen Gruppen abgrenzen können.
Sie helfen aber auch, innerhalb der Gruppe zusammenzufinden: Es bringt mir ja nichts, wenn nur ich weiß, welcher neue Sessel welches Statussignal sendet. Andere Menschen, die eine ähnliche Position auf der Statusleiter haben, müssen es auch wissen und wir müssen es voneinander wissen.
Keine Form der Diskriminierung ist gesellschaftlich so akzeptiert, wie jene anhand von Status. Im Gegensatz zu z. B. Frauen-, Schwulen-, Ausländerfeindlichkeit, die inzwischen geächtet sind. Warum ist das so?
Wenn ich sage, dass meine Kinder Migrationshintergrund haben, was strenggenommen die Wahrheit ist, sind die Leute immer ganz verdutzt. Denn Migrationshintergrund ist in Wahrheit ein sozialer Begriff. Man meint Menschen mit weniger Bildung, ökonomisch schwach, aus Syrien oder Rumänien – und nicht den wohlhabenden Einwanderer aus Norwegen. Karl Lagerfeld wird wenig Schwulenfeindlichkeit erlebt haben. Auch Frauenfeindlichkeit ist oft ein Klassenphänomen. Auch diese Diskriminierungsformen sind unterlegt mit sozioökonomischem und soziokulturellem Status.
Eine andere Diskriminierungsform ist ähnlich akzeptiert wie Klassismus: Attraktivität. Wenn man jemanden als schön bezeichnet und daher sympathischer findet, wird das akzeptiert. Ebenso passiert einem nichts, wenn man sich klassistisch äußert. Aber wenn man die Sachen über Rassenunterschiede sagen würde, die man über Klassenunterschiede sagt, müsste man Sorge haben, ob man am nächsten Tag noch seinen Job hat.
Ökonomische Ressourcen sind nur ein indirekter Hinweis darauf, ob ich über Intelligenz, Persönlichkeit, Charakter und Integrität verfüge. Die reine Geldmenge zählt sozial gar nichts
Wie definieren sich Klassen heute? Nicht nur über das reine Vermögen?
Es war nie nur Vermögen. Wir sind eine kulturelle Spezies, man konnte Prestige immer auch durch besondere Fertigkeiten als Koch, Geschichtenerzähler oder Athlet erringen. Schon der geschickteste Höhlenmaler signalisierte damit, dass er manuell geschickt und kognitiv gut ausgestattet ist, also schlau und kompetent. Diese Fähigkeiten zählen zu den „teuren Signalen“. Das sind in allen Gesellschaften und Kulturen Statussignale.
Ökonomische Ressourcen sind nur ein indirekter Hinweis darauf, ob ich über Intelligenz, Persönlichkeit, Charakter und Integrität verfüge. Die reine Geldmenge zählt sozial gar nichts. Ich könnte sie ja durch Verbrechen oder Zuhälterei erworben haben. Wenn man mit Bordellen sehr viel Geld verdient, ist das nichts, was man den Eltern der Klassenkameraden der Kinder erzählt, denn das ist sozial überhaupt nichts wert. Geld erhöht nur dann den Status, wenn mein Gegenüber daraus schließen kann, dass ich bestimmte als wertvoll erachtete und schwer zu fälschende Eigenschaften habe.
Wer kein Geld (mehr) hat, kann Status immer noch durch exquisiten Kunstgeschmack oder besondere moralische Haltungen signalisieren.
Absolut. In Gesellschaften, in denen das ökonomische Niveau relativ hoch ist, steigt die Wichtigkeit dieser nichtökonomischen Faktoren sogar an, weil die Menschen materiell ausreichend versorgt sind. Klassenwettbewerbe müssen da in einer anderen Währung ausgetragen werden.
Ich habe Zweifel an den von Ihnen genannten „fälschungssicheren“ teuren Signalen. Sie schreiben, eine kostspieligen Villa signalisiert, ein ernstzunehmender Geschäftspartner zu sein. Es gibt den in Österreich und Deutschland bekannten Fall eines Immobilieninvestors, der teure Villen bewohnte und zur Jagd einlud – heute steht er vor Gericht. Er hat Statussignale gesendet, aber Klasse würde man ihm heute nicht zuschreiben. Fälschungssicher waren seine Signale also nicht.
Man sieht ja an den Fotos von dessen Anzügen und Häusern, dass das ästhetisch nicht trittsicher ist. Man erkennt geschmacklose Aufsteiger-Protzerei sofort. Es gibt sicher einige Menschen, die die Grammatik der oberen Klasse lernen können, aber wirklich Eingeweihte erkennen das trotzdem sofort. Sie haben Recht, es ist nicht unmöglich, Statussignale zu faken. Aber man sieht, dass man selbst mit großem Erfolg über viele Jahre am Ende doch nicht die richtigen Anzüge trägt und irgendein hässliches Haus bewohnt.
Die absolute Oberklasse würde so jemand nicht akzeptieren?
Sie glauben doch nicht, dass das alte Wiener Geld diesen Herrn eingeladen hat oder zu seinen Empfängen gegangen ist. Ich wäre auch nicht hingegangen.
Gegenbeispiel: Paul McCartney. Er stammt aus einer Mittelschichtfamilie, heute ist er „Sir“ Paul.
Das ist ein außergewöhnlicher Fall, der sich daraus erklärt, dass er Künstler ist und das kulturelle Kapital der 68er, aus dem sich noch bis vor Kurzem die Führungsetagen und die Elite der Gesellschaft rekrutiert haben, sehr geprägt hat. Wenn man 30 Lieder komponiert hat, die zu den größten Hits aller Zeiten gezählt werden, wird man auch respektiert.


Das Buch
Welche Signale lassen auf den Status einer Person schließen, welche sind fälschungssicher und warum sendet die absolute Elite oft nur noch versteckte Signale aus? Die Codes der Society beschreibt Hanno Sauer in „Klasse. Die Entstehung von Oben und Unten“. Piper, € 27,50
Menschen können andere mit recht hoher Sicherheit sogar anhand anonymisierter Fotos der richtigen Klasse zuordnen. Wie sieht es mit der Selbsteinschätzung aus? Ordnet man sich der richtigen Gesellschaftsschicht zu oder stapelt man hoch?
Es gibt die McArthur Scale Of Subjective Social Status, anhand derer sich Menschen selbst einordnen sollen. Das ist eine Leiter mit zehn Sprossen. Studien haben gezeigt, dass sich Leute sehr gut anhand von Kriterien wie Einkommen, Universitätsabschluss etc. einschätzen. Wir sind in der Eigenwahrnehmung unseres Status sehr genau, ob die Leute diesen dann öffentlich eingestehen, ist wieder eine andere Frage.
Wenn es nur ums Einkommen geht, ordnet sich eine übergroße Gruppe der „Mittelschicht“ zu. Selbst der frühere steirische Landeshauptmann tat das – bei einem Monatseinkommen von 20.000 Euro.
Das Gleiche hatten wir mit Friedrich Merz, der sich zur Mittelschicht zählte, obwohl er Multimillionär ist und im Privatflugzeug fliegt. Das ist natürlich völliger Unsinn. Mag sein, dass diese Leute ihre sozioökonomische Herkunft meinen und andeuten wollen, dass sie aus normalen Verhältnisse stammen. Ich weiß auch nicht, warum Politiker sich dieses Eigentor einhandeln. Besser beraten wären sie, wenn sie sagen: Ich weiß, dass ich nicht mehr zu dieser Klasse gehöre, aber ich will trotzdem meinen Einfluss und meine Fähigkeiten nutzen, um eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Das wäre eine ehrlichere Botschaft und würde besser angenommen werden als diese Unaufrichtigkeit.
Den meisten Menschen in Europa geht es besser als früher, immer weniger müssen um ihren Lebensunterhalt kämpfen. Trotzdem verlieren wir nicht die Angst vor dem Statusverlust. Warum?
Eben weil mit zunehmender materieller Absicherung die Knappheit von immateriellen Faktoren stärker wahrgenommen wird. Bei allen messbaren Verbesserungen bei Gesundheit, Lebenserwartung, Wirtschaft gibt es trotzdem dieses Gefühl der Prekarität, der Bedrängtheit, der Gehetztheit, dass alles irgendwie schlechter ist.
Das liegt daran, dass Statusängste intensiver wahrgenommen werden, weil sich mehr Wettbewerb auf symbolische Felder verlegt. Gegen sozial konstruierte Knappheit kann man auch nichts unternehmen. Früher waren Autos ein Statussymbol, dann wurden immer mehr Fahrzeuge hergestellt, heute kann fast jeder eines haben. Das funktioniert bei Status nicht. Wenn nur ein Prozent der Menschen zur absoluten Elite zählt, kann man das nicht ändern, indem man einfach mehr Elitezugang herstellt. Ein Prozent ist immer ein Prozent.
Was man heute tun kann: Öffentlichen Raum wie etwa Parks etc. zu erhalten, wo man sich unter Gleichen begegnen kann, ohne gleich das Portemonnaie zücken zu müssen. Ein gut ausgebauter Wohlfahrtsstaat und soziale Infrastruktur
Die Angst um Statusverlust generiert frustrierte soziale Gruppen, was wiederum den Rechtsruck in vielen Ländern erklärt. Wobei die Rechtsparteien gegen Eliten, Systemparteien und Systemmedien wettern.
Das machen Populisten immer: Sie sagen „Wir sind die Anwälte des einfachen Mannes oder der schweigenden Mehrheit. Die Eliten schauen auf euch herab, die finden, ihr riecht nicht gut und habt keinen Geschmack.“ Da ist ja auch ein bisschen etwas dran. Natürlich denken die Eliten so. In dem Maße, in dem Statushierarchien wichtiger werden und der Entzug von Anerkennung bestimmter sozialer Gruppen zunimmt, kreiert das den Bedarf nach Gegeneliten, die die Mainstream-Eliten abschaffen wollen. Das sehen wir beim Brexit, bei Trump, der AfD. In den Niederlanden und in Österreich gab es mit Geert Wilders und Jörg Haider die Pioniere dafür. Glückwunsch!
Kann die Politik diese Entwicklung bremsen?
Es gibt wenig politische Mittel, um dagegen etwas zu tun. Und es gibt andererseits sehr viele Mittel, um diese Stimmung auszunutzen. Es ist sehr leicht, syrischen Flüchtlingen für alles die Schuld zu geben. Ein Blatt wie die Bild schreibt: „Das ist Murat, der hat drei Ehefrauen und lebt vom Sozialstaat“. Das verkauft sich in Deutschland fünf Millionen Mal.
Aber zu sagen „Okay, wenn ihr dieses Problem verstehen wollt, liebe Wähler, dann müsst ihr euch erst einmal einen 45-Minuten-Vortrag über die soziostrukturellen Entwicklungen der letzten 35 Jahre anhören, und die Umstellung von Industrie auf Wissensgesellschaft“, funktioniert natürlich nicht. Es geht ja um reale Entwicklungen. Im Ruhrgebiet sind ganze Industriezweige verschwunden. Es bringt einem Kumpel nichts, wenn man ihm sagt, er solle doch programmieren lernen.
Was wäre eine gerechtere Gesellschaft?
Man kann Stände abschaffen, was in Deutschland und Österreich mit dem Adel gemacht wurde. Das ist auch gut so, denn dass es offizielle Privilegien gibt, ist mit modernen Gesellschaften nicht mehr vereinbar. Was man heute tun kann: Öffentlichen Raum wie etwa Parks etc. zu erhalten, wo man sich unter Gleichen begegnen kann, ohne gleich das Portemonnaie zücken zu müssen. Ein gut ausgebauter Wohlfahrtsstaat und soziale Infrastruktur. Die Möglichkeit an öffentlichen Unis zu studieren, ohne Elite-System wie in den USA. Ansonsten glaube ich, dass die politischen Mittel sehr beschränkt sind, denn Status kann man nicht umverteilen.
Letzte Frage: Warum soll man Ihr Buch lesen? Weil es ein Statussymbol ist, Sachbücher junger Starautoren zu lesen, die einem suggerieren, danach eingeweiht zu sein, wie sie selbst schreiben?
Dieses Buch ist bis an die Zähne bewaffnet mit Ironie. Man sollte es lesen, wenn man sich ein tieferes Verständnis von Gesellschaft verschaffen will. Leser sagen mir, sie sehen die Welt nun mit anderen Augen und gucken die ganze Zeit auf irgendwelche Codes und Statussymbole. Wenn man das lehrreich findet, oder vielleicht auch nur unterhaltsam, dann sollte man das Buch lesen.

Steckbrief
Hanno Sauer
Hanno Sauer studierte Philosophie in Marburg und Frankfurt, promovierte an der Universität Groningen und habilitierte an der Uni Duisburg-Essen, seit 2022 lehrt er Ethik an der Universität Utrecht. 2023 erschien sein erstes Buch „Moral. Die Erfindung von Gut und Böse“ (Piper Verlag), das für den deutschen Sachbuchpreis nominiert war.
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 47/2025 erschienen.