Was kann jeder und jede Einzelne beitragen, um die Gesellschaft, in der wir leben, zum Besseren zu verändern? Mit dieser Frage beschäftigt sich Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der Mega Bildungsstiftung, in seinem neuen Buch. Ein Gespräch über die Behäbigkeit der österreichischen Institutionen - und die Notwendigkeit, trotzdem an Veränderung zu arbeiten.
Der gebürtige Steirer Andreas Ambros-Lechner studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaften in Wien und war einst der erste Mitarbeiter eines politischen Projekts von Matthias Strolz – aus dem die heutige Regierungspartei Neos entstehen sollte. Später gründete er das Social Business Sindbad* mit, das jugendlichen Pflichtschulabsolventen Mentoren zur Seite stellt, und fungiert seit 2019 – und noch bis Oktober 2025 – als Generalsekretär der Mega Bildungsstiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, innovative Bildungsinitiativen in Österreich zu unterstützen.
*Sindbad bringt Jugendliche aus Brennpunktschulen mit Mentoren in Verbindung, um ihre Chancen auf Arbeit und Bildung zu erhöhen.
Neues Buch
In seinem neuen Buch „Wirken“ zeigt Ambros-Lechner – ausgehend von seiner eigenen Lebensgeschichte – auf, wie jeder und jede Einzelne etwas zur Gesellschaft beitragen kann. Gerade in Zeiten, in denen es oft schwierig ist und Ängste und Unsicherheiten dominieren. Denn für gesellschaftlichen Fortschritt brauche es Menschen mit Engagement und Visionen, ist er überzeugt.
Sie haben durch das Social Start-up Sindbad, aber auch als Generalsekretär der Mega Bildungsstiftung versucht, das System von außen zu verändern. Wie sehr braucht es solche Initiativen?
In Österreich ist viel staatlich und öffentlich organisiert, und das finde ich auch in weiten Teilen gut so. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass es von der Seite, von der Zivilgesellschaft, auch mehr Initiativen und schlagkräftige Initiativen braucht, um dieses große staatliche System auch in Bewegung zu bringen. Diese Initiativen haben natürlich mehr Freiraum, Dinge auszuprobieren und umzusetzen. Aber die große Frage ist: Gibt es Durchlässigkeit, damit eine Innovation, die an kleinen Orten funktioniert, auch ins größere Gesamtsystem übernommen werden kann? Daran habe ich in den letzten zehn Jahren unter anderem gearbeitet.
Erfolgreich?
Teilweise schon, aber es ist ein bisschen David gegen Goliath. Allein wenn ich mir anschaue, wie groß das Bildungsbudget ist – mit elf, zwölf Milliarden pro Jahr –, und dann vergleiche, wie kleinere Initiativen, Vereine, NGOs budgetär aufgestellt sind, sieht man eine große Disbalance. Und dennoch merke ich, dass es von einigen Behördenvertretern oder von der Verwaltung, auch von der Politik, immer mehr Interesse gibt, Brücken zu bauen.
Wie tragfähig sind diese Brücken?
Die budgetär schwierige Situation ist auch eine Chance, darüber nachzudenken, ob man als Staat oder Politik mit zivilgesellschaftlichen oder auch mit wirtschaftlichen Akteuren nicht intensiver zusammenarbeiten will. Denn ganz allein wird man diese Probleme nicht lösen können. Wir haben in Österreich eine Denke, wir zahlen viele Steuern und der Staat wird’s schon richten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Mindset zukunftsweisend ist.
Wir zahlen ja wirklich genug Steuern und das Bildungsbudget ist auf dem Papier groß genug.
Und dennoch gehören wir nicht zu den besten Bildungssystemen europa- oder weltweit. Das heißt, Geld alleine ist es ja nicht. Man spricht ja oft davon, dass die Schüler-Lehrer-Beziehung sehr wichtig ist und dass Schulen erfolgreich sind, die auch insgesamt eine starke Beziehungskultur haben – innerhalb der Schule, aber auch mit ihren Partnern und zu den Eltern hin. Und ich denke, dass diese Beziehungen auch ein oder zwei Ebenen drüber, im Verhältnis zu NGOs und zur Wissenschaft, eine neue Qualität brauchen. Das System hat von sich heraus nicht genug Innovationskraft, um das von selber zu schaffen.
Ihr Buch handelt davon, wie man „die Welt zum Guten ändern kann“, so der Untertitel. Mit welchen Problemen kämpft unsere Gesellschaft?
Das Grundgefühl ist eine gewisse Sättigung, die einerseits zu Trägheit und auch Ohnmacht führt. Dieses soziale Aufstiegsversprechen der letzten Jahrzehnte gibt es ja jetzt nur mehr bedingt. Vor 20 Jahren hätten noch viele gesagt: „Meinen Kindern soll es einmal besser gehen als mir.“ Mittlerweile sagen viele schon: „Ich hoffe, meinen Kindern geht es nicht schlechter.“ Der Glaube an und auch die Möglichkeit eines Aufstiegs ist überschaubarer geworden. Und dann gibt es halt auf individueller, aber auch auf politischer Ebene die Antwort darauf, noch schneller zu werden und zu versuchen, Lösungen zu finden, man bleibt aber an der Oberfläche, weil die Dinge ja auch immer verflochtener werden. Angesichts dieser Unübersichtlichkeit der Welt im Großen, aber auch im Kleinen, Konkreten muss man überlegen, wie man sich selbst gut führt. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe von jedem Einzelnen. Und gleichzeitig braucht es einen Rahmen, in dem sich diese unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Möglichkeiten möglichst gut entfalten können.
Sich selbst in Zeiten wie diesen gut zu führen – wie geht das?
Zunächst muss man die Realität einmal anerkennen und darüber nachdenken, was sie mit mir zu tun hat. Ich finde es auch wichtig, in die eigene Lebensgeschichte zu schauen. Damit man selber weiß, wer man ist, immer wieder aufs Neue. Um überhaupt handlungsfähig zu sein für einen Beitrag in der Gesellschaft.

Steckbrief
Andreas Ambros-Lechner
hat in Wien Wirtschaft und Politik studiert und war erster Mitarbeiter der heutigen Regierungspartei Neos. Er begründete das Social Business Sindbad mit und versucht seit 2019, sich als Generalsekretär der Mega Bildungsstiftung für mehr Bildungsinnovationen und -gerechtigkeit in Österreich einzusetzen.
Erster Schritt: Erkenne dich selbst?
Ja, so simpel es klingt, aber ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist. Und wenn ich dann weiß, wo meine Stärken und Schwächen liegen, wo meine Interessen liegen, dann bin ich eigentlich erst bereit dafür, mit meiner Umgebung in Austausch zu gehen. Das ist einmal die engere Umgebung, Familie, Freunde, Berufskolleginnen. Und dann – das ist eine Kernaussage von meinem Buch – sollte man nachdenken, was mein Handeln, mein Job, mein ehrenamtliches Engagement mit der Gesellschaft zu tun hat. Was kann ich da beitragen? Das ist für jeden etwas anderes. Das kann vom kleinen Verein über politisches Engagement bis hin zum Start-up-Gründer, der nicht Millionen machen, sondern vor allem einen Impact erreichen will, alles sein.
Sollte sich jeder und jede in der Gesellschaft engagieren?
Ich finde, ja. Je nach Möglichkeiten. Und Engagement ist da wirklich breit gedacht bei mir. Da geht es einfach um ein soziales, menschliches Miteinander. Um die Haltung, die ich gegenüber Mitmenschen und der Umwelt einnehme. Die Rolle, die ich für mich in Bezug auf die Gesellschaft, in der ich lebe, definiere.
Man hört oft große Klagen über den Zustand Österreichs. Als jemand, der versucht, das System von außen zu ändern, wie ist Ihr Eindruck? Geht alles den Bach runter? Versagt die Politik? Sind wir tatsächlich in einer Abwärtsspirale gefangen?
Nein, so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Ich bin es auch ein bisschen leid, in diesen Chor einzustimmen. Ja, es gibt Baustellen und Probleme. Andererseits gibt es auch viele Beispiele und Orte in Österreich, wo Dinge sehr gut funktionieren. Es gibt super Schulen, es gibt super Unternehmen, es gibt super Krankenhäuser, es gibt lokal und regional super politische Initiativen, die funktionieren. Aber es kann trügerisch sein. Ich beschreibe in meinem Buch Eindrücke von einer Reise nach Vietnam vor ein paar Jahren, extrem viele junge Menschen, viel Lust und Freude. Und da kommst du nach Österreich zurück und spürst diese gedämpfte Stimmung. Es gibt natürlich auch in Österreich Orte der Zuversicht, eher im privaten als im politmedialen Kontext, glaube ich. Diese Zuversicht gilt es, mehr zu kultivieren, auch indem man mehr Positivbeispiele vor den Vorhang holt.
Haben wir eine Kultur des Schlechtredens in Österreich?
Wir reden in den Medien und in der Politik sicherlich zu wenig über das Gute, Funktionierende. Und Österreich ist nicht gut in der Problemanerkennung. Da wurstelt man sich als klassischer Österreicher irgendwie durch, und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Erfolgsgeheimnis bleiben wird. International, vor allem außerhalb Europas, gibt es viele hungrige, motivierte Menschen. Die Entwicklungen im Bereich Wirtschaft sind teilweise furchteinflößend. Und gleichzeitig wollen wir ja am European Way of Life mit Menschenrechten, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit festhalten. Das sind schon Fragen, die die Stimmung trüben können, selbst wenn es einem in seinem eigenen, privaten Mikrokosmos gut geht
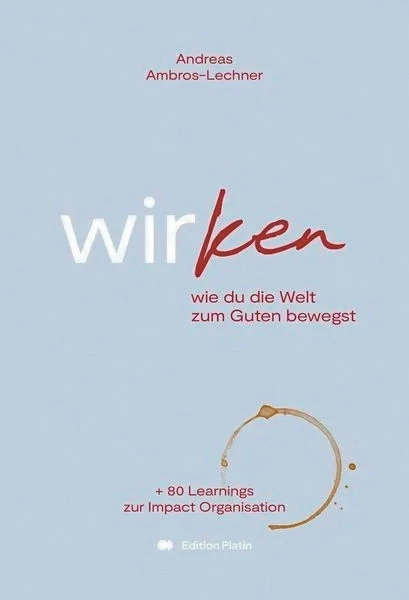
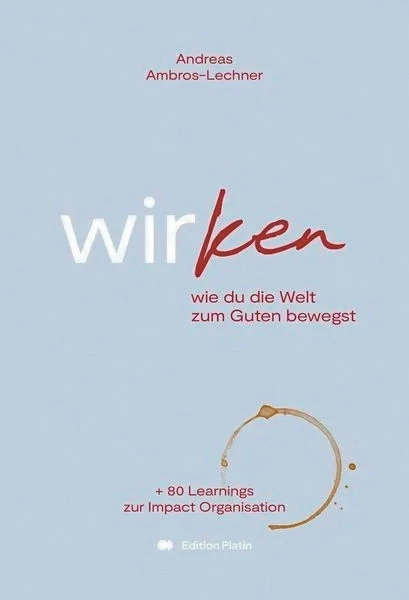
Das Buch
In seinem neuen Buch „Wirken – wie du die Welt zum Guten bewegst“ reflektiert Andreas Ambros-Lechner seine eigene Lebensgeschichte und vermittelt „80 Learnings zur Impact Organisation“.
Edition Platin, € 24
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 38/2025 erschienen.







