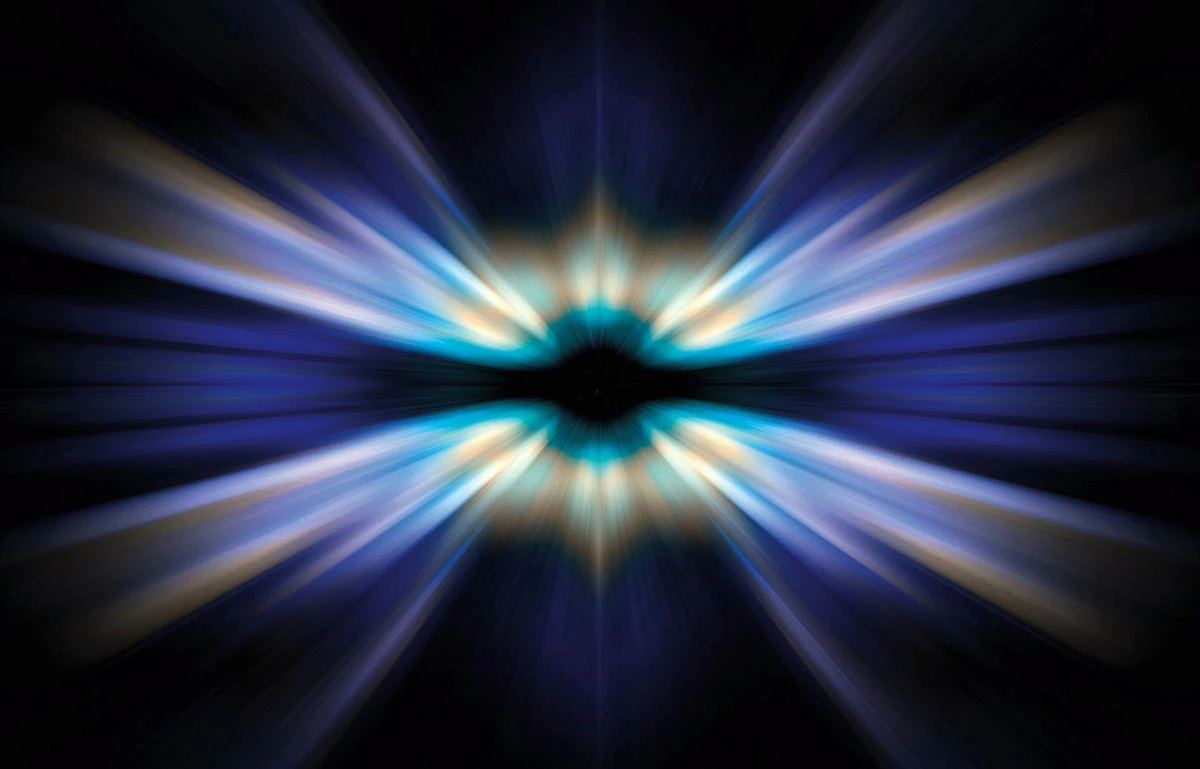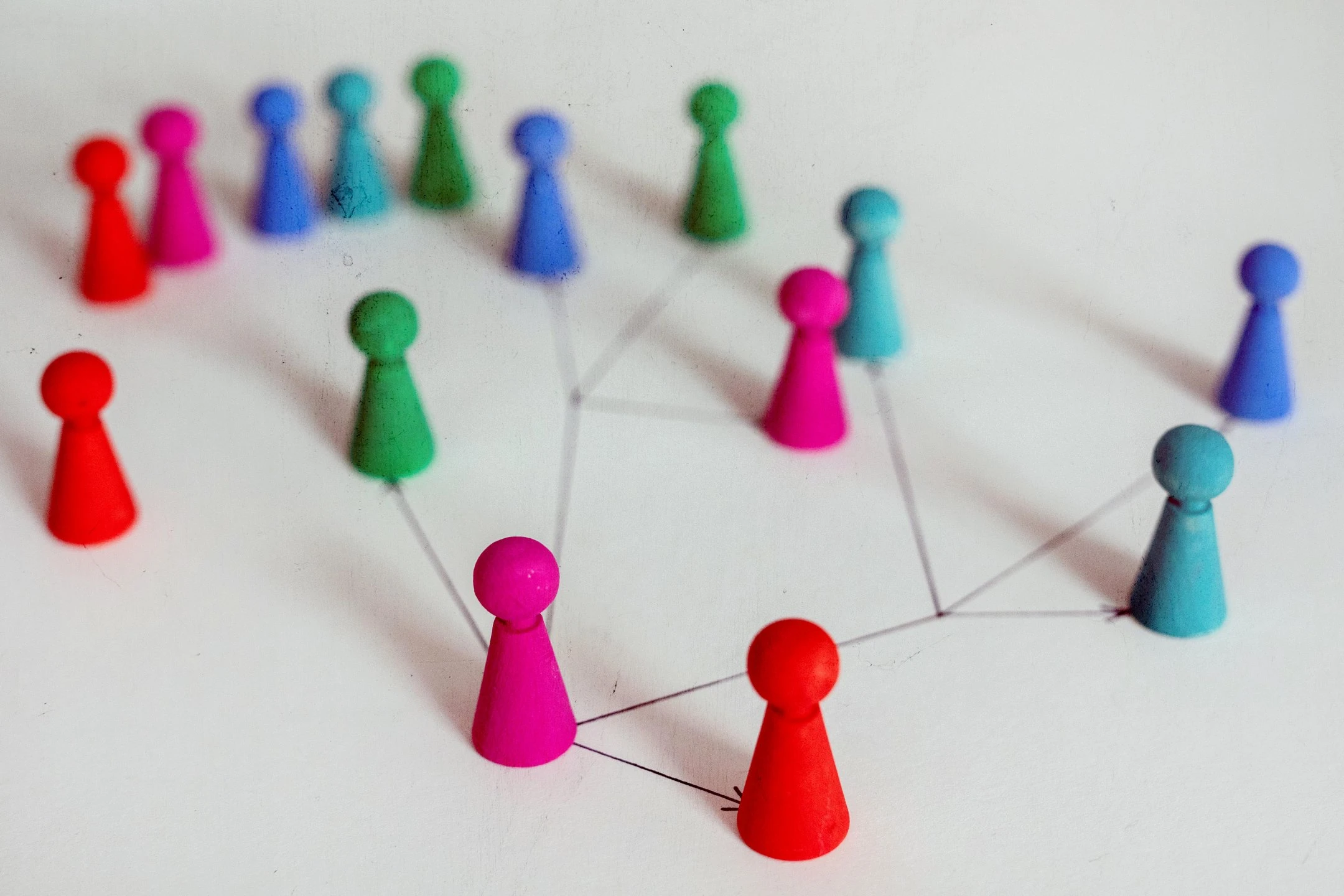Woran erkenne ich eine Depression? Ab wann brauche ich Medikamente? Und wer ist besonders gefährdet? Prof. Johannes Wancata, Leiter der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie der MedUni Wien, gibt Antwort auf die wichtigsten Fragen.
von
- Woran erkenne ich eine Depression?
- Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede?
- Wie erfolgt die Diagnose?
- Welche Ursachen kann eine Depression haben?
- Wie wird eine Depression behandelt?
- Medikamente oder Psychotherapie?
- Ab wann muss ich in die Klinik?
- Was hilft unterstützend bei einer Depression?
- Kann ich einer Depression vorbeugen?
- Welche Berufsgruppen sind besonders gefährdet?
Woran erkenne ich eine Depression?
"Vieles, das einem sonst Freude macht, macht keine Freude mehr", beschreibt Wancata ein typisches Anzeichen einer Depression. Man könne nichts mehr so richtig genießen und tendiere dazu, die Dinge negativ zu sehen. Anfangs treten die Symptome meist vereinzelt auf. Oft fühlt sich der Betroffene energielos. "Der Schwung fehlt." Hinzu kommen Ein- und Durchschlafprobleme. Auch Appetitlosigkeit ist möglich. "Es gibt eine kleine Gruppe, die deutlich mehr isst. Die meisten nehmen aber eher ab", schildert der Experte.
Vieles, das einem sonst Freude macht, macht keine Freude mehr
Viele leiden unter Mundtrockenheit, manche zittern oder schwitzen mehr. Je stärker ausgeprägt die Depression, desto deutlicher treten die Symptome zutage. Das kann so weit gehen, dass der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, den Alltag zu bewältigen. Er zieht sich zurück - auch von Familie und Freunden -, schafft es mitunter nicht einmal mehr aus dem Bett, geschweige denn in die Arbeit. Nicht zuletzt leidet auch das Sexualleben unter der Erkrankung. "Bei den meisten nimmt die Libido ab", erklärt Wancata. Da hinter manchen der genannten Symptome auch ein körperliches Leiden wie zum Beispiel Diabetes, Blutarmut, eine Lungen- oder Tumorerkrankung stecken kann, ist es wichtig, dies durch entsprechende Untersuchungen im Vorfeld auszuschließen.


Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede?
Insgesamt sind mehr Frauen als Männer betroffen. Dies dürfte hormonelle Gründe haben. Auch die oftmalige Mehrfachbelastung von Frauen in der Gesellschaft könnte eine Rolle spielen. Einer Studie aus dem Jahr 2017 zufolge lag der Anteil weiblicher Betroffener im Jahr davor bei zwölf, der Anteil männlicher bei sieben Prozent. "Bei Männern kommt es häufiger zu Abhängigkeitserkrankungen", erläutert Wancata geschlechtsspezifische Unterschiede, die sich vereinzelt auch in der Symptomatik zeigen. Hierüber herrsche vonseiten der Forschung aber noch kein Einklang. Was man allerdings immer wieder beobachten könne, ist, dass depressive Männer häufiger ein gereiztes Verhalten an den Tag legen.
Wie erfolgt die Diagnose?
"Die meisten Menschen haben einen Hausarzt, den sie schon lange kennen, bei dem sie vielleicht regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen machen und von dem sie sich, wenn notwendig, krankschreiben lassen." Bei den ersten Anzeichen empfiehlt es sich, diesen aufzusuchen. Die Diagnose erfolgt über ICD-10, ein international gültiges Klassifikationssystem für Krankheiten. Das Wichtigste dabei sei das Gespräch, betont Wancata, in dem man den Patienten fragt, wie es ihm gehe, wie er schlafe, ob er vielleicht weniger Energie habe als früher oder ihm vieles keinen Spaß mehr mache.
Das könnte Sie auch interessieren:
Eine wesentliche Rolle bei der Diagnose spielt auch die Beobachtung. "Wenn mir zum Beispiel auffällt, dass der Patient langsamer ist als früher - sowohl in der Motorik als auch beim Reden." Zudem zeige der Betroffene im Zuge des Gesprächs oft eine vermehrt negative Sichtweise. "Wenn man ihn fragt, wie es der Familie oder im Beruf geht, schildert er alles sehr pessimistisch", weiß der Psychiater. Oft fällt das dem Patienten selbst gar nicht auf. Vielmehr ist er der Meinung, dass er lediglich die Realität beschreibt. Nicht erkennbar ist eine Depression dagegen via Blutuntersuchung. Lediglich eine ungesunde Lebensweise als Folge der Depression könne sich hier zeigen. Für gewöhnlich ist das aber erst dann der Fall, wenn die Depression schon sehr lange andauert.
Welche Ursachen kann eine Depression haben?
Menschen, die über längere Zeit hinweg starken Belastungen ausgesetzt sind, laufen eher Gefahr, eine Depression zu entwickeln. "Ein erhöhtes Risiko besteht zum Beispiel, wenn man seinen Job verliert." Gelingt es nicht, ins Berufsleben zurückzukehren, dauert die Depression mitunter umso länger. "Oft reicht es aber auch schon", so der Experte, "wenn viele kleine Alltagsbelastungen zusammenkommen." Ebenso eine Rolle spielen können körperliche Erkrankungen wie Parkinson, Schilddrüsenfehlfunktionen, Durchblutungsstörungen oder schwere Lebererkrankungen sowie genetische Faktoren. "Häufig ist es ein Zusammenspiel von Genetik und Umwelt", sprich Menschen mit einer gewissen genetischen Disposition reagieren auf Belastung, indem sie krank werden.
Oft reicht es schon, wenn viele kleine Alltagsbelastungen zusammenkommen
Ungeachtet der Ursache geht eine Depression stets mit einer Imbalance der Botenstoffe im Gehirn, der sogenannten Transmitter, einher. Genauer gesagt kommt es in manchen Regionen des Gehirns zu einem Mangel besagter Botenstoffe. Betroffen ist dabei vor allem das serotogerge und das noradrenerge System. Genau hier könne man dann auch mit Medikamenten ansetzen, ergänzt Wancata.
Auch interessant: Vom Burnout zurück in den Job - So gelingt der Wiedereinstieg
Wie wird eine Depression behandelt?
Eines vorweg: In den meisten Fällen lässt sich eine Depression recht gut behandeln. Einige wenige Betroffene werden sogar ohne Unterstützung wieder gesund. Darauf verlassen, dass das passiert, sollte man sich allerdings nicht. Je länger nämlich die Depression andauert, desto höher ist das Risiko, dass sie chronisch wird, sprich die Symptome über Jahre hinweg auftreten, was über kurz oder lang meist auch zu Problemen im familiären oder beruflichen Bereich führt.


Die zwei wesentlichen Eckpfeiler der Behandlung sind Psychotherapie einerseits und Medikamente anderseits. "Es gibt kein Medikament, dass keine Nebenwirkungen hat", so der Psychiater. In der Entwicklung entsprechender Präparate habe sich in den letzten 15, 20 Jahren aber enorm viel getan. So könne man heute auf Medikamente zurückgreifen, die mindestens ebenso gut wirken wie deren Vorgänger, gleichzeitig aber wesentlich weniger Nebenwirkungen haben. Welches Mittel letztlich verabreicht wird, müsse stets individuell entschieden werden. "Es gibt Leute, die ein bestimmtes Medikament ganz schlecht vertragen. Andere wiederum vertragen es super."
Wichtig dabei sei zu wissen, dass Antidepressiva nicht abhängig machen. Im Gegensatz zu Schlafmitteln und Tranquilizern. Bis Antidepressiva ihre volle Wirkung entfalten, kann es bis zu fünf Wochen dauern. "Bis dahin geht es den Leuten nicht gut." Also setzt man in der Zwischenzeit auf letztgenannte Medikamente - um die innere Unruhe zu mindern und den Schlafrhythmus wieder zu normalisieren. Eine heilende Wirkung haben aber weder Schlaf- noch angstlösende Mittel. Zumal sie ausschließlich zeitlich begrenzt und nur unter ärztlicher Verschreibung und Beratung eingenommen werden dürfen.
Medikamente oder Psychotherapie?
Bei einer schweren Depression, die vielleicht sogar mit Suizidalität einhergeht, ist eine medikamentöse Behandlung unumgänglich. Auch schon deshalb, weil die Erkrankung das Denken derart verlangsamen kann, dass eine Psychotherapie zu diesem Zeitpunkt gar nicht möglich ist. Bei einer lang andauernden Depression wiederum empfiehlt sich eine Psychotherapie. Ist die Depression nur leicht ausgeprägt, kann der Patient in der Regel selbst zwischen den beiden Behandlungsmöglichkeiten wählen. "Manche wollen die Einnahme von Medikamenten möglichst vermeiden, andere sagen: 'Lasst's mich mit dem Gerede in Ruhe und gebt's mir ein Medikament, damit ich wieder funktioniere.'"
Ab wann muss ich in die Klinik?
Eine stationäre Behandlung ist dann notwendig, wenn der Patient derart schwer erkrankt ist, dass er im Alltag nicht mehr alleine zurechtkommt. In den meisten Fällen reicht jedoch eine ambulante Behandlung. Ein Vorteil Ersterer liegt darin, dass man auf potenzielle Nebenwirkungen schneller reagieren kann. Von daher besteht im Spital die Möglichkeit, die Dosis der Medikamente - wenn nötig - schneller zu erhöhen, um auf diese Weise den Genesungsfortschritt zu unterstützen. "Eine stationäre psychiatrische Behandlung ist keine Einbahnstraße! Der allergrößte Teil der Patienten wird freiwillig aufgenommen und geht auch wieder freiwillig."
Eine stationäre psychiatrische Behandlung ist keine Einbahnstraße
Wird die Depression von Suizidgedanken begleitet, ist rasches Handeln angesagt. "Da darf man dann nicht sagen: 'Ich hab eh in drei Wochen einen Termin beim Arzt'", mahnt der Experte, der auf ein engmaschiges Netz an Hilfsangeboten verweist. Hier ein Auszug:
Telefonseelsorge (telefonische Beratung bei Krisen): Unter der Notrufnummer 142 gebührenfrei 24 Stunden am Tag
Kriseninterventionszentrum Wien (Beratung bei Krisen persönlich, telefonisch oder per Chat): 1090 Wien, Lazarettgasse 14A oder 01 4069595, Mo–Fr 10–17 Uhr
Sozialpsychiatrischer Notdienst und Psychosoziale Information Wien (PSD): Betreuungsangebote bei psychischen Erkrankungen oder Krisen, auch mobil zu Hause aufsuchend, 0-24 Uhr (telefonisch und persönlich) 01 31330; 1030 Wien, Modecenterstraße 14/C/1
WEIL - Weiter im Leben, Hilfe für suizidgefährdete junge Menschen und deren Angehörige: 8010 Graz, Sparbersbachgasse 41, 0664 3586786 (Onlineberatung)
Was hilft unterstützend bei einer Depression?
Bei einer leichten oder mittelschweren Depression kann Bewegung ergänzend zur eigentlichen Therapie hilfreich sein. "Wer schwer depressiv ist, schafft das nicht." Eine weitere Möglichkeit, die Genesung zu unterstützen, ist Ergotherapie. "Ergotherapie fällt in den Bereich der Soziotherapie", erklärt der Professor für Sozialpsychiatrie. Mit ihr könne sich der Patient ein Bild über seinen aktuellen Zustand machen: Kann ich mich konzentrieren? Wie steht es um meine Leistung? Kann ich sie im Laufe der Zeit steigern? Derartige Aspekte erfahrbar zu machen, kann gerade für Menschen, die schon seit längerer Zeit nicht mehr am Berufsleben teilnehmen, hilfreich sein.
Passend dazu: Depression - So gehen Sie mit Betroffenen um
Ebenso förderlich ist eine Tagesstruktur. Geregelte Zeiten, in denen konkrete Tätigkeiten auf dem Programm stehen, können dabei helfen, aus einer langen, schweren Depression herauszukommen. Darüber hinaus könne man auch mit den Angehörigen des Patienten arbeiten - allerdings nur, wenn dieser damit einverstanden ist. Auf diese Weise könne man Schuldzuweisungen nach dem Motto "Du hast was falsch gemacht, sonst wärst du nicht krank geworden" entgegenwirken. "Das ist eine Depression", betont der Psychiater. "Für die kann keiner was. Das zu verstehen ist für Angehörige ein Lernprozess."


Kann ich einer Depression vorbeugen?
Das Wissen über mögliche Präventionsmaßnahmen ist dem Experten zufolge begrenzt, was schlicht und einfach daran liegt, dass es schwierig ist, Menschen, denen es grundsätzlich gut geht, dazu zu motivieren, an derartigen Studien teilzunehmen. Was man aber wisse, sei, dass es von Vorteil ist, wenn man über ein gut funktionierendes soziales Netz verfügt und ins Berufsleben eingebunden ist. Weil dies Stabilität gibt und Belastungen reduziert. "Garantie ist das aber auch keine." Zudem gebe es Belastungen, denen man nicht vorbeugen könne. Etwa wenn der Partner plötzlich schwer erkrankt und fortan mehrere Stunden täglich auf Unterstützung angewiesen ist.
Welche Berufsgruppen sind besonders gefährdet?
Es gibt Berufe, die mit einer höheren psychischen Belastung einhergehen als andere. Dass daraus automatisch eine Depression erwächst, ist damit aber nicht gesagt. Eher gehe es hier um die Gefahr, in ein Burnout zu schlittern. Diese sei vor allem in Sozialberufen gegeben. Zudem zeigen Studien, dass die Suizidalität bei medizinischem Personal, und da vor allem bei Ärzten, deutlich höher ist als in anderen Berufsgruppen. Weil hier oft mehrere belastende Faktoren zusammenkommen, wie etwa ein hohes Arbeitspensum bei möglicherweise begrenztem Erfolg, ein fehlender Tag-Nacht-Rhythmus und mitunter auch die Beeinträchtigung von Familienleben und Sozialkontakten. Dass es in weiterer Folge zu einer Depression kommt, kann sein, muss aber nicht sein.

Steckbrief
Johannes Wancata
Prof. Johannes Wancata ist Leiter der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der MedUni Wien.
Wenn Sie Suizidgedanken haben oder sich um jemanden sorgen, kontaktieren Sie bitte die Psychiatrische Soforthilfe unter 01/31330. Sie bietet rund um die Uhr Rat und Unterstützung im Krisenfall. Die österreichweite Telefonseelsorge ist unter 142 ebenfalls jederzeit gratis zu erreichen.