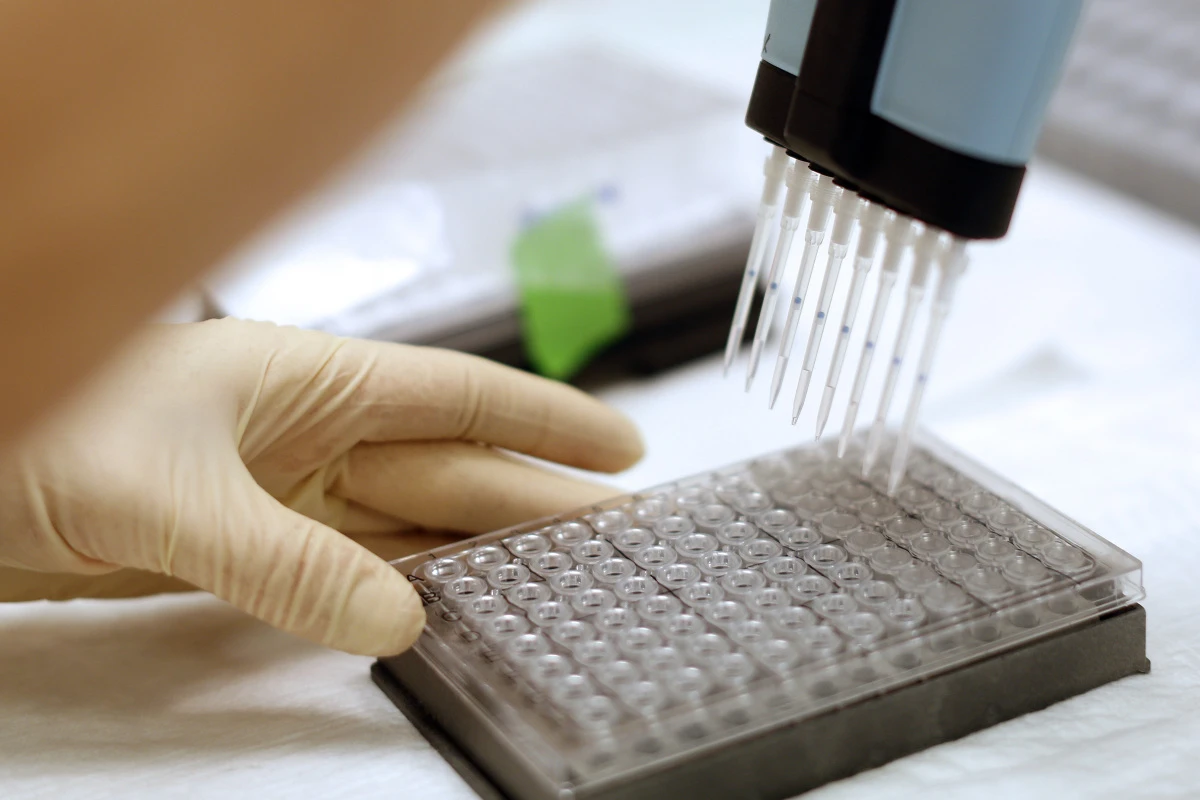von
Für ihre Studie verglichen die Forscherinnen und Forscher Daten über die regionalen Ökosysteme ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts mit dem geschätzten Zustand nach dem Ende der letzten Eiszeit zu Beginn des Holozäns vor rund 12.000 Jahren, heißt es in der Publikation. So versuchte man, in Jahresschritten möglichst kleinräumig nachzuzeichnen, ob und wie stark die Flächen durch menschliches Handeln quasi abgewirtschaftet oder degradiert wurden.
Dabei konzentrierte man sich darauf, wie viel Biomasse regional sozusagen auf natürlichem Wege produziert werden kann, und wie viel der Mensch "durch Abernten von Pflanzen, Pflanzenresten und Holz, aber auch die Verringerung der Photosynthese-Aktivität durch Landnutzung und Flächenversiegelung" herausnimmt, wie es in einer Aussendung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) heißt. PIK-Forschende haben die Studie in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Soziale Ökologien der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien durchgeführt. Dazu kommt eine "Ökosystem-Risikokennzahl", die Vegetationsveränderungen und Wasser-, Stickstoff- und Kohlenstoffbilanzen berücksichtigt, heißt es.
Das Ergebnis: Vor allem in den mittleren Breiten offenbarten sich demnach schon um das Jahr 1600 ungünstige Entwicklungen. Um das Jahr 1900 befanden sich 37 Prozent der Landflächen außerhalb des definierten "sicheren Bereiches" für die jeweilige Region. Um die 14 Prozent der Flächen erfüllten vor 125 Jahren die Voraussetzungen für die Einstufung "Hochrisikozone". Wenig überraschend wurde es der Analyse zufolge seither auch alles andere als besser: Aktuell hätten sich 60 Prozent aus dem sicheren Bereich entfernt, während schon 38 als Hochrisiko-Raum geführt werden.
Die größten Problemfelder liegen laut den Forscherinnen und Forschern in Europa, Asien und Nordamerika. In diesen alten und schon lange intensiv genutzten Kulturräumen wurde die Vegetation bekanntlich stark im Sinne der Bedürfnisse der Landwirtschaft verändert. Insgesamt sehe man auch, dass die großflächigen negativen Auswirkungen der menschlichen Landnutzung sich deutlich früher merklich abgezeichnet haben, als dies bei der Erderwärmung der Fall ist, die erst in den vergangenen Jahrzehnten richtig greifbar wurde.
Mit der "ersten Weltkarte zum Überschreiten der Belastungsgrenze der funktionalen Integrität der Biosphäre", wie es PIK-Direktor Johan Rockström ausdrückt, setze man "einen wichtigen Impuls für die weitere Entwicklung der internationalen Klimapolitik". Die Politik sollte nämlich "den umfassenden Schutz der Biosphäre zusammen mit dem Klimaschutz" behandeln, wird Rockström zitiert.
(S E R V I C E - https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101393)