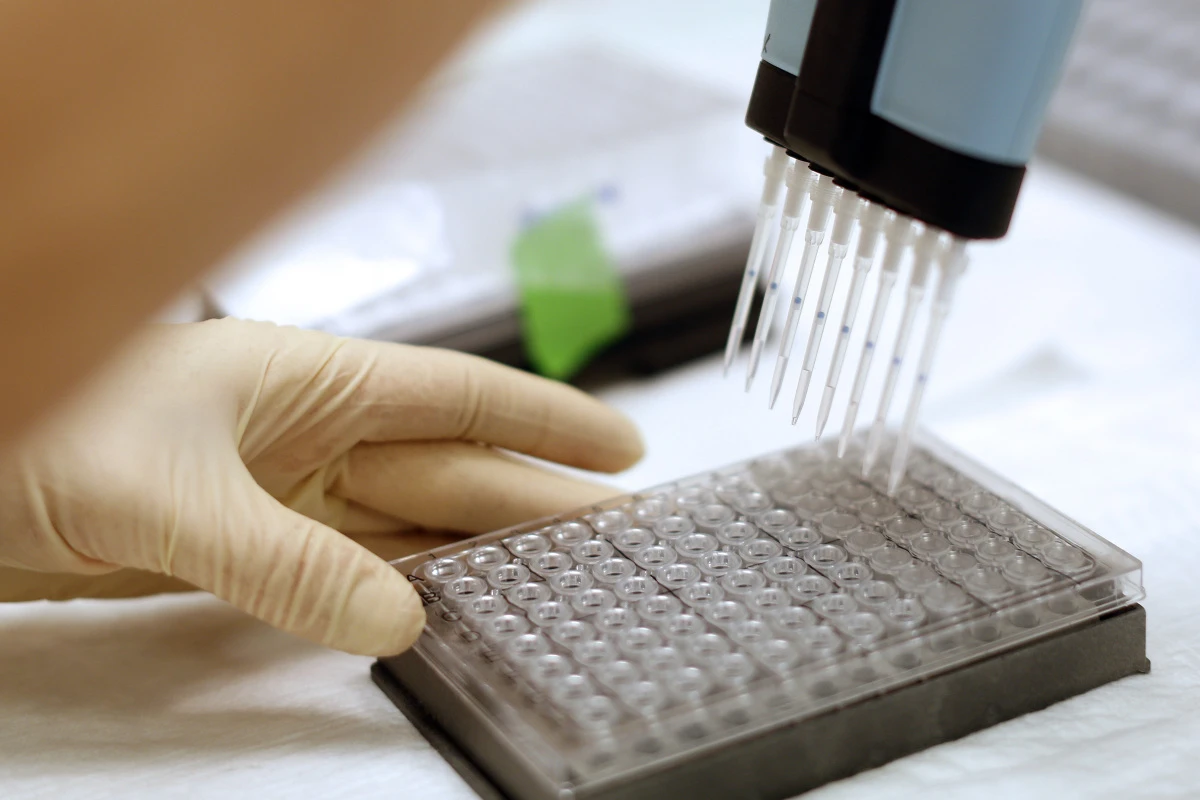von
In der Quantenwelt verhält sich Materie sowohl als Teilchen als auch als Welle. Diese Welle-Teilchen-Dualität kann man an Lichtteilchen (Photonen) besonders gut zeigen. Diese offenbaren ihre Welleneigenschaft im bekannten Doppelspaltexperiment: Schickt man die Teilchen auf eine Wand mit zwei schmalen, parallelen Spalten, so entstehen auf einem Schirm dahinter helle und dunkle Bereiche - ein charakteristisches Interferenzmuster. In statistischen Untersuchungen kann dann nachgewiesen werden, dass die Photonen mehrere Wege gleichzeitig gingen. Dass das auch bei anderen Teilchen funktioniert, zeigte der Physiker Helmut Rauch (1939-2019), als er 1974 am Wiener Atominstitut aus einem Silizium-Kristall das erste Neutronen-Interferometer herstellte.
Und sogar deutlich massivere Teilchen wie Atome können unter bestimmten Umständen Quanteneigenschaften an den Tag legen. Das lässt sich nutzen, um wertvolle Informationen über die Beschaffenheit und Eigenschaften von Materialien zu gewinnen, wie Forscherinnen und Forscher vom Institut für Quantentechnologien des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Ulm nun gezeigt haben.
Sie entwarfen mit theoretischer Unterstützung des Teams um Toma Susi von der Abteilung Physik Nanostrukturierter Materialien an der Fakultät für Physik der Universität Wien eine entfernt verwandte Hightech-Abwandlung des klassischen Doppelspaltexperiments: Bei der Transmissionsmikroskopie wird ein Elektronenstrahl auf ein zu untersuchendes Werkstück gerichtet und damit sozusagen durchleuchtet. Das erlaubt erstaunliche Einsichten in den Aufbau bis hinunter auf die Ebene einzelner Atome, was die Elektronenmikroskopie zu einem der mächtigsten Werkzeuge für die Materialwissenschaft werden ließ. Allerdings ist diese Methode sehr strahlungsintensiv und daher für viele Proben, wie etwa organisches Material, schlechter geeignet, wie es in einer DLR-Aussendung heißt.
Daher interessieren sich Forschende für weniger zerstörerische Messmethoden. Eine Idee ist, die aggressiven Elektronenstrahlen durch elektrisch neutrale Atome zu ersetzen. In so einem Strahl kommen die Welleneigenschaften der Atome zum Tragen. Richtet man diese "Materiewellen" auf einen Festkörper, werden sie an ihm gebeugt, was mit Elektronen schon vor 100 Jahren demonstriert wurde. Hinter der neuen Atomstrahl-Anordnung sollte dann ein Quanteninterferenz-Wellenmuster entstehen, aus dem sich in der Folge Rückschlüsse über die Feinstruktur der durchflogenen Probe ziehen lassen, möglicherweise ohne sie stärker zu schädigen.
Das Team um die Hauptautoren der Publikation, Carina Kanitz und Christian Brand vom DLR, hat das nun umgesetzt. In einer Vakuumkammer brachten sie Wasserstoff- und Heliumatome auf Geschwindigkeiten von bis zu zwei Millionen Kilometer pro Stunde. Damit schossen sie auf eine Graphen-Schicht, die aus nur einer Lage Kohlenstoffatome besteht. Unter diesen speziellen Umständen umfliegen die schnellen Atome in ihrem Quanten-Überlagerungszustand (Kohärenz) gleichzeitig mehrere Kohlenstoffatome im Graphen-Gitter. Hinter diesem Aufbau offenbarte sich dann bei der richtigen Geschwindigkeit tatsächlich das erhoffte Beugungsmuster auf einem Detektorschirm. Aus dem Muster lässt sich laut DLR-Angaben auf die Atomanordnung in der Probe rückschließen.
Die Grundlage für die nunmehrige Arbeit wurde in Brands Zeit an der Uni Wien gelegt. Die dort entwickelten Simulationen gingen aber zunächst davon aus, dass es niedrigere Energien - vulgo Geschwindigkeiten - der Atome braucht, um die Quantenkohärenz nicht zusammenbrechen zu lassen. Nun stellte sich heraus, dass der Schlüssel in der Beschleunigung liegt, wie Susi gegenüber der APA erklärte. In den neuen Simulationen zu den Experimenten zeigt sich überdies, warum die fragilen Quanteneigenschaften beim Beschuss erhalten bleiben: Die fliegenden Atome wechselwirken mit jenen im Graphen-Gitter nur den Millionsten Teil einer Milliardstel Sekunde lang, wie Susi erklärte.
Auf dem nun gezeigten Weg "wird es möglich, auch viel komplexere Materialkombinationen zu untersuchen", zeigt sich der Physiker überzeugt. Wie dick diese maximal sein können, ohne dass das Interferenzmuster verschwindet, sei noch offen. "Wir haben schon Simulationen bereitgestellt, um zu zeigen, dass dies für mindestens zwei Graphenschichten noch möglich sein wird", so Susi. Was alles möglich ist, müsse mit weiteren Materialien getestet werden. Groß sei jedenfalls das Interesse an übereinandergeschichteten sogenannten 2D-Materialien, wie es Graphen ist.
Sehr interessiert sei man auch daran, ob Atomstrahlen tatsächlich weniger schädlich als der Beschuss mit geladenen Teilchen sind. Ist dem so, ergeben sich neue Möglichkeiten in der Analyse von organischen Materialien im Bereich der Strukturbiologie, in der organischen Chemie bis hin zum Durchleuchten und Testen von Materialien für Elektronikbauteile und in der Raumfahrt, wo ständiger Teilchenbeschuss herrscht. Außerdem erhofft man sich Anwendungen in der Quantenwissenschaft.
(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.1126/science.adx5679)
++ THEMENBILD ++ Signalschild aufgenommen vor einem Labor zur Polarisation und Verschränkung von Lichtteilchen (Photonen) am Mittwoch, 6. Dezember 2023, an der Fakultät für Physik der Universität Wien. Ein Ziel der Quantenoptik ist es, die Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie zu beschreiben. Laser gilt hier als optimale Lichtquelle für die Versuche.