Bereits in absehbarer Zeit werden Künstliche Intelligenz und Roboter die menschliche Arbeit in einem hohen Ausmaß ersetzt haben. Was bedeutet das für die Menschheit? Der Ethiker Peter G. Kirchschläger hat sich Gedanken darüber gemacht und bietet in seinem neuen Buch „Ethics and the Digital Transformation of Human Work“ Lösungen an. Im exklusiven News-Interview legt er seine Ideen dar.
von
Sie sind Ethiker, Theologe, Philosoph, Uni-Professor – wie wahrscheinlich ist es, dass Sie durch KI bzw. datenbasierte Systeme (DS) ersetzt werden?
Bei einigen meiner Aufgaben ist das sehr wahrscheinlich, weil DS günstiger sind. Wir beobachten, dass mit DS zwar nicht die gleiche Qualität erreicht wird wie bei Menschen, weil es sich nur um Nachahmung handelt, dass sie im Sinne der Kosteneffizienz aber so viel attraktiver sind als menschliche Arbeit, dass es zu Verdrängung kommen wird – bei allen beruflichen Aufgaben.
Macht Ihnen das Angst?
Ich habe nicht wirklich Angst. Ich bringe ethisch und rational begründbare Kritik vor, die ermutigen soll, unsere Gestaltungsverantwortung wahrzunehmen. Wollen wir Qualitätseinbußen in Bereichen, wo uns DS unterlegen sind, in Kauf nehmen? Oder wollen wir die Entwicklung so organisieren, dass wir Aufgaben, wo es Menschen braucht, in menschlichen Händen lassen, und DS nur dort einsetzen, wo sie die gleiche oder bessere Qualität erreichen? Bei meiner Arbeit als Uni-Professor ist zwischenmenschliche Interaktion wesentlich. Auch in ethischen Entscheidungen braucht es weiterhin den Menschen.
Viele Menschen haben Angst, dass sie durch DS ersetzt werden.
Es ist ein realistisches Szenario, dass es zu einer massiven Reduktion bezahlter beruflicher Aufgaben kommt. Ich verstehe, dass Menschen das als Bedrohung wahrnehmen. Darum müssen wir ja versuchen, das Ruder in die Hand zu bekommen. Derzeit treiben einige wenige multinationale Technologiekonzerne diesen technologischen Fortschritt voran, und wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist nicht demokratisch legitimiert. Ich würde mir wünschen, dass hier die internationale Gemeinschaft das Steuer übernimmt.
Wo haben wir das Ruder aus der Hand gegeben?
Im Bereich des Lebensmittelhandels etwa verdrängen automatisierte Kassensysteme Menschen aus dem Arbeitsprozess. Diese Instrumente dienen nicht dazu, ihnen die Arbeit zu erleichtern, sie verlieren ihre Jobs. Im Bereich der Pflege hingegen wird erst darüber nachgedacht, Pflegeroboter einzusetzen. Dafür gibt es Interessen der Industrie, es gibt den Kostendruck im Gesundheitssystem, es gibt einen Fachkräftemangel. Es scheint sinnvoll, Roboter zum Patiententransport einzusetzen.
Andererseits: Wenn das der einzige Moment von zwischenmenschlicher Aktion und Berührung ist, sollte man noch einmal genauer hinschauen, ob es nicht eine Kombination von Mensch und Roboter braucht. Man muss sagen: Eine massive Reduktion bezahlter beruflicher Aufgaben ist noch kein ethisches Problem. Es kann auch positiv sein, dass wir mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben haben. Wir müssen aber überlegen, wie wir das Wirtschaftssystem anders gestalten, wenn wir uns gerade vom Streben nach Vollbeschäftigung verabschieden.
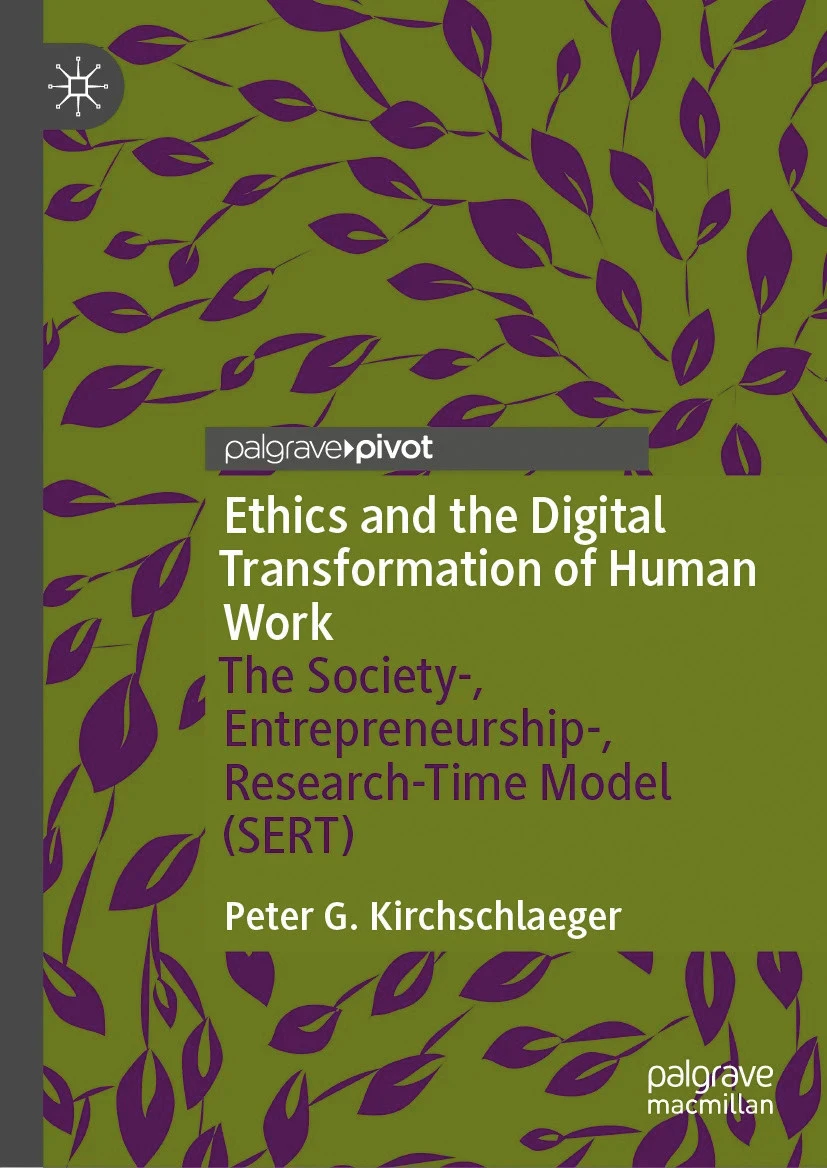
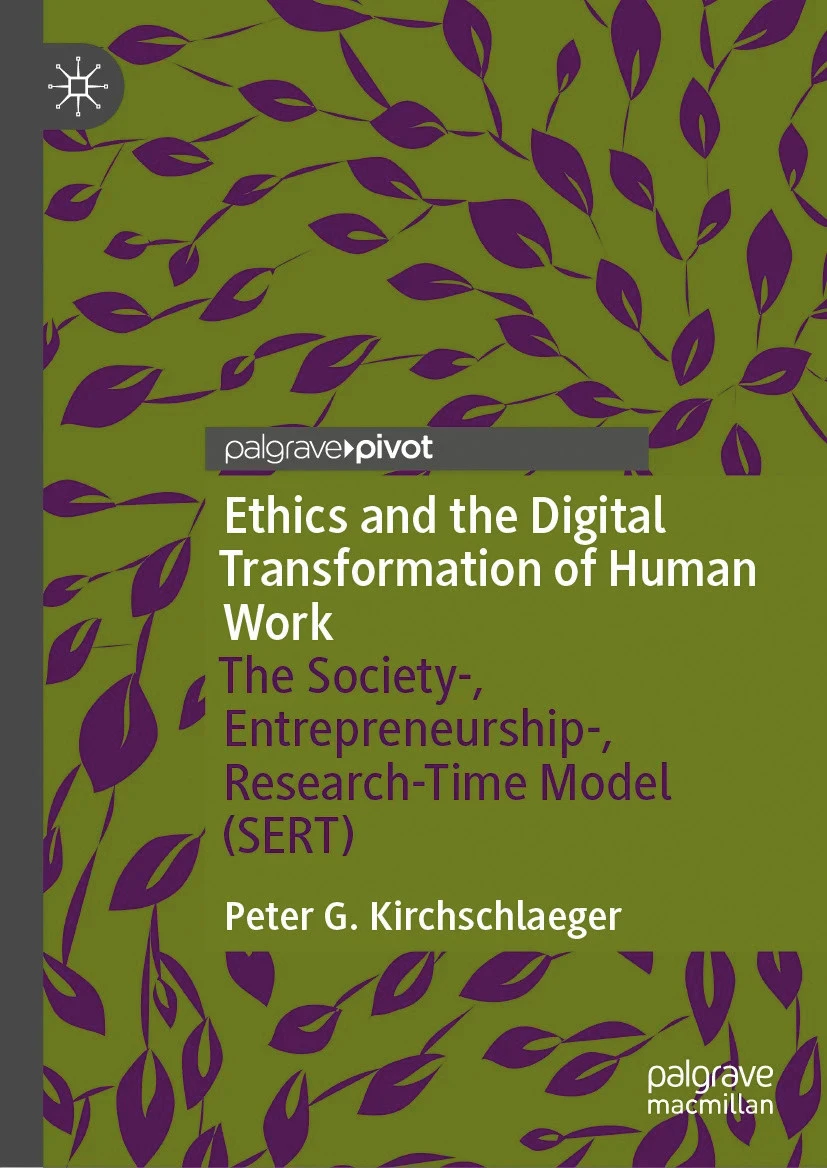
Das Buch
Das Buch „Ethics and the Digital Transformation of Human Work. The Society-, Entrepreneurship-, Research-Time Model (SERT)“ erscheint zunächst in englischer Sprache. Eine deutschsprachige Ausgabe ist geplant. Palgrave Macmillan Cham, € 43,99
Die Industrialisierung habe langfristig mehr Jobs gebracht, heißt es, man möge den Wandel nicht pessimistisch sehen. Sie widersprechen: DS sind darauf ausgelegt, uns zu ersetzen.
Studien kommen zu unterschiedlichen Zahlen: Manche sagen, 50 Prozent der bezahlten beruflichen Aufgaben werden wegfallen, andere 70 bis 80 Prozent. Es geht jedenfalls um eine massive Reduktion. Dieser Tatsache muss man ins Auge schauen. Ich finde es verantwortungslos, zu sagen, bildet euch fort, macht euch digital fit. Wenn wir eines nicht wissen, dann das: Wie die Jobs in Zukunft aussehen werden und ob es sie überhaupt gibt. Wie gehen wir ethisch verantwortungsvoll mit dieser Situation um? Man sollte jedenfalls den Denkfehler vermeiden, dass wie bei früheren technologiebasierten Wandelepochen nur niedrigqualifizierte Jobs betroffen sind, oder dass mehr, neue Jobs entstehen.
Was kann der Einzelne tun?
Als Bürgerinnen und Bürger haben wir die Möglichkeit, uns in demokratische Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozessen einzubringen. Mir ist aus ethischer Perspektive wichtig, dass weniger bezahlte Arbeit nicht unbedingt schlecht sein muss. Wir müssen aber überlegen, wie wir das als Gesellschaft so organisieren, dass weiterhin für alle ein menschenwürdiges Dasein garantiert ist.
Ich schlage ein bedingtes Grundeinkommen vor, im Rahmen eines Society-Entrepreneurship-Research-Time-Modell (SERT). Ein Grundeinkommen, das so hoch ist, dass wir nicht nur physisch überleben, sondern ein menschenwürdiges Dasein führen können. Als Gegenleistung hätten wir eine Society-Time zu leisten, in der wir in einem frei gewählten Bereich gesamtgesellschaftlich relevante Aufgaben erfüllen. Arbeit ist ja sinnstiftend, identitätsstiftend. Die Gelegenheit dazu soll es in der Society-Time geben. Man wäre aber davon befreit, wenn man unternehmerisch tätig ist, forscht oder sich in Innovationsprozessen einbringt.
Wer legt fest, was gesellschaftlich wertvoll ist?
Das würde ich breit und offen anlegen.
Plakatives Beispiel: Ein Laufhaus-Betreiber wäre von der Society-Time befreit? Ob sein Tun gesellschaftlich wertvoll ist – da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten.
Da haben Sie recht. Aber ich würde das Modell aus grundsätzlicher Wertschätzung für das Unternehmertum sehr offen anlegen.
Ein früherer Finanzminister hat über „Orchideenfächer“ in der Forschung gespöttelt. Auch hier: keine Einschränkungen?
Gerade bei der Forschung weiß man nie so genau, was herausschauen könnte. Oft kommt der gesamtgesellschafliche Nutzen eher überraschend. Auch hier gilt es, eine grundsätzlich fundamentale Wertschätzung für Forschung und Wissenschaft zum Ausdruck zu bringen.
Kritiker des Grundeinkommens sagen, Menschen würden sich in die Hängematte legen. Soll Society-Time Missbrauch ausschließen?
Als Ethiker treibt mich diese Sorge nicht herum, weil ich grundsätzlich den Menschen vertraue, dass sie etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit anfangen können. Mir geht es bei der Society-Time darum, Erfahrungen zu ermöglichen, die man bisher in bezahlter Arbeit gemacht hat: Strukturierung des Alltags, Zusammenwachsen der Gesellschaft, den Umgang mit Menschen lernen, die man sich nicht selbst ausgesucht hat. Missbrauch wird es immer geben, also in diesem Fall Menschen, die etwas als Society-Time angeben, dass nicht dem gesellschaftlichen Wohl dient, oder die sich drücken wollen. Aber man sieht bei anderen sozialstaatlichen Instrumenten: Ihre Zahl wird zwar gerne politisch hochgekocht, ist aber eigentlich statistisch irrelevant.
Es wird sehr schwer sein, rationale Gründe zu finden, warum Unternehmen, die sich mit DS dumm und dämlich verdienen, nicht wirklich besteuert werden
Ihre Idee ist, dass SERT global ausgerollt wird. Wie finanziert man das?
Man kann SERT schrittweise in Regionen aufgleisen, die intensiver von der Reduktion bezahlter Arbeit betroffen sind. Zur Finanzierung: Die Kernkonsequenz der digitalen Transformation und des Einsatzes von DS ist eine effizientere und effektivere Wertschöpfungskette. Am Ende schaut mehr raus, nur nehmen weniger Menschen daran teil und profitieren davon.
Weil man weniger Arbeitskräfte bezahlen muss?
Ja, und weil eine Maschine sieben Tage 24 Stunden arbeitet, keinen Urlaub will und nicht krank wird. Daher gibt es mehr finanzielle Mittel, um das Grundeinkommen zu finanzieren. Das würde natürlich bedingen, dass diese Mittel durch Steuern der Gesellschaft auch zur Verfügung stehen. Mit datenbasierten Dienstleistungen werden Milliarden erwirtschaftet, aber keine Steuern gezahlt. Das gilt es zu ändern.
Also Google und Co. zur Kasse bitten.
Die globale Mindeststeuer für multinationale Konzerne war ein erster Schritt in diese Richtung, das sollte man weiterverfolgen. Es wird sehr schwer sein, rationale Gründe zu finden, warum Unternehmen, die sich mit DS dumm und dämlich verdienen, nicht wirklich besteuert werden.
Tech-Giganten flüstern Donald Trump ein, was sie davon halten. Und der droht dann Europa.
Dennoch glaube ich, dass es mit der internatiolen Besteuerung schnell gehen kann. Der Druck wird rasant ansteigen, wenn sehr, sehr viele Menschen – mehr als unsere Sozialsysteme auffangen können – arbeitslos sind. Oder wenn es die erste Generation von Schulabsolventinnen und -absolventen gibt, die niemals einen Job finden. Dann könnte der Druck in einzelnen Staaten so groß werden, dass man sich den machtmissbräuchlichen Aktivitäten des aktuellen US-Präsidenten vehementer entgegenstellt, als es die EU oder die Schweiz jetzt tun.
Von welchem Zeithorizont sprechen wir da? Ein Jahr, fünf Jahre, zehn?
Eher von fünf Jahren. Wenn wir davon ausgehen, dass der technologiebasierte Wandel in immer kürzeren Intervallen stattfindet, haben wir bald mit fundamentalen Veränderungen zu rechnen. Daher sollte man viel intensiver darüber nachdenken, wie wir unser Wirtschaftssystem gestalten. Solche Veränderungen brauchen ja auch Zeit. Wirtschaftliche und politische Entscheidungsträgerinnen und -träger müssen sich der Realität stellen, dass wir uns vom Streben nach Vollbeschäftigung verabschieden. Die Verantwortung für diese systemische Veränderung darf nicht dem Einzelnen aufgebürdet werden.
Digitalisierung wird als Chance für den Staat gesehen, zu sparen.
Es wird sich aber auch die Frage stellen, ob man in manchen Bereichen überhaupt noch Menschen anstellen will. Denken Sie an Roboter-Chirurgie. Man kann sagen, Chirurginnen und Chirurgen haben dann mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten. Aber ist man dann noch bereit, jemand für die Gespräche mit den Menschen anzustellen? Die aktuellen Debatten im Gesundheitssystem lassen darauf schließen, dass das nicht der Fall sein könnte.
Laut Stephen Hawking könnte die Digitalisierung „das schlimmste Ereignis in der Geschichte der Zivilisation werden“.
Aus ethischer Sicht ist es ratsam, diese Möglichkeit mitzudenken und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Es gibt bereits die Möglichkeit, dass sich DS selbstständig weiterentwickeln – auch in heiklen, sicherheitsrelevanten Bereichen. Wenn wir das nicht anpacken, verlieren wir wirklich die Kontrolle. Es sollte eine Art Notfallknopf geben, durch den Menschen immer die Letztkontrolle haben und Prozesse stoppen können. Tun wir das aktuell? Nein. Sollten wir es tun? Auf jeden Fall.
Dass DS sich selbst weiterentwickeln wird eher als Fortschritt gesehen.
Dabei verstehen wir gar nicht mehr, was sie machen. Die Mathematik dahinter ist so komplex, dass wir wieder andere DS bräuchten, die diese Komplexität herunterbrechen und so übersetzen, dass die besten Mathematikerinnen und Mathematiker das noch verstehen. Wir sind auf dem Weg, die Kontrolle zu verlieren. Denken Sie an automatisierte tödliche Waffensysteme, die sich unserer Befehlsgewalt entziehen. Das kann für die Menschheit gefährlich werden. Ich schlage eine internationae UN-Agentur für datenbasierte Systeme (IDA), analog zur Atomenergiebehörde, vor, die den menschenrechtsbasierten Umgang mit DS kontrolliert und bei Verstößen sanktioniert, um Schlimmeres zu verhindern. Ein Beispiel: Es gibt ganz legal eine App, die Kinderbilder sexualisiert. Damit wird massiv Geld verdient. Ein Produkt, das Menschenrechte so verletzt, dürfte gar nicht auf den Markt kommen.
Überwiegen für Sie die Chancen der DS oder die dystopischen Aussichten?
Es gäbe enorme ethische Chancen, insbesondere in Wissenschaft und Forschung. Diese sollten wir viel gezielter verfolgen. Aktuell laufen wir Gefahr, alles nur mit den Scheuklappen der Effizienzsteigerung zu sehen. Es gilt in erster Linie, die ethischen Risiken zu vemeiden: Menschenrechtsverletzungen, Kinderrechtsverletzungen, Umweltzerstörung bei der Schürfung von Rohstoffen, Entwicklung und Nutzung von DS. Die ethischen Chancen können wir ja dennoch verfolgen.
Wenn Sie also in fünf Jahren viel Zeit haben – was planen Sie?
Angenommen, wir haben SERT eingeführt und können ein menschenwürdiges Dasein ohne bezahlte berufliche Tätigkeit führen, würde ich meine Society-Time für Menschen auf der Flucht und in Migration einsetzen. Die Zeit, die mir darüber hinaus bleibt, geht an Familie, Freundinnen und Freunde sowie Sport. Das wäre mein Plan.

Steckbrief
Peter G. Kirchschläger
Der gebürtige Wiener ist in der Schweiz aufgewachsen. Er hat Theologie und Judaistik studiert und ist Professor für theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik an der Universität Luzern sowie Gastprofessor an der ETH Zürich.
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 39/2025 erschienen.







