Der Historiker Kurt Bauer sammelt in seinem neuen Buch „Niemandsland zwischen Krieg und Frieden“ Berichte aus dem Jahr 1945 und zeigt dabei eindrucksvoll, aus welch turbulenten Verhältnissen die Zweite Republik entstand: von Chaos, Hoffnung, Angst zu dem Erfolgsmodell, das Österreich heute ist
Obwohl erst 1961 geboren, beginnt Kurt Bauer sein neues Buch mit „seinem“ Jahr 1945 –dem Bericht über seinen Großvater, nationalsozialistischer Bürgermeister einer kleinen Gemeinde im Murtal, den das Schicksal in diesem letzten Kriegsjahr mit einem fußballerisch talentierten Metallarbeiter aus dem Roten Wien zusammengeführt hat, der Beginn einer Lebensfreundschaft.
Ein Jahr, in dem sich so viele dramatische und tragische Geschichten zutrugen, wie damals Menschen lebten: Bauer erzählt eine Handvoll dieser Geschichten nach. Jene von Karl Pisa zum Beispiel, ein junger Soldat, dem eine Schussverletzung im März 1945 ein frühzeitiges Kriegsende und die Heimkehr nach Wien ermöglichten. „Im Ducken und Springen und Rennen plötzlich eine Art Stoß, ein elektrischer Schlag oder Ähnliches. Blut am Ärmel.“ So beginnt das Buch, und geht bis zu den letzten Tagen jenes schicksalhaften Jahres, in dem der große Krieg endete.
Im Interview erklärte Bauer, wie er die Berichte zusammengetragen hat, was aus der Geschichte zu lernen ist und welches der beschriebenen Schicksale ihn persönlich besonders berührt hat.
Wie sehr hat das Jahr 1945 die nachfolgenden Jahre und Jahrzehnte beeinflusst?
Weil heute alle paar Monate von einer „Zeitenwende“ die Rede ist: 1945 spielte sich tatsächlich eine Zeitenwende ab, wie es in der Menschheitsgeschichte kaum eine zweite gab. Der bis dahin größte, verlustreichste globale Krieg ging zu Ende. Zugleich markierte das Jahr den Übergang in die mehr als 40 Jahre dauernde Phase des Kalten Kriegs. Und dann eine für alle Zeiten unwiderrufliche Tatsache, der 6. und 9. August 1945, die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, die Menschheit vor der Möglichkeit, sich selbst auszulöschen. 1945 ging die 1914 – oder nach anderen Lesarten 1917 oder 1918 – begonnene Umbruchphase von der alten, europazentrierten in eine neue Welt zu Ende, die bis 1989/91 vom US-amerikanisch-sowjetischen Gegensatz geprägt war und jetzt in eine Phase von multipolaren Krisen im Zeichen eines „Clash of Cultures“ eingetreten ist.
Auch in Österreich endete die Phase des Übergangs, die mit dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 eingesetzt hatte. Aber nicht 1918 markierte aus österreichischer Sicht die wahre Zeitenwende, sondern 1945. Und es war definitiv eine Wende hin zum Besseren, auch wenn das damals ganz und gar nicht absehbar war. Im Gegenteil: 1945 fragen sich die Menschen, wie sie unter den gegenwärtigen Umständen überhaupt weiterleben sollten.
Sie haben eine beeindruckende Menge an Berichten zusammengetragen. Woher stammen die?
Die von mir für das Buch verwendeten Ego-Dokumente stammen zum kleineren Teil aus publizierten Büchern, so zum Beispiel das in jeder Hinsicht lesenswerte „Wiener Tagebuch 1944/45“ des Diplomaten Josef Schöner oder das „Kriegstagebuch“ von Ingeborg Bachmann. Zum allergrößten Teil habe ich aber Material der „Doku Lebensgeschichten“ verwendet, einer Einrichtung der Uni Wien, an der seit mehr als 40 Jahren lebensgeschichtliche Erzählungen und andere autobiografische Materialien systematisch gesammelt werden. Bei der wissenschaftlichen Arbeit mit diesen historischen Dokumenten ist mir schon vor vielen Jahren klar geworden, welche zentrale Rolle im Leben der Menschen das Jahr 1945 gespielt hat. Denn 1945 war so gut wie jeder und jede von den Ereignissen persönlich betroffen. Wenn Sie so wollen, war jedes Leben ein Roman. Und viele Menschen haben diesen Roman auch aufgeschrieben. Das sind die Quellen, aus denen ich geschöpft habe.
Nach welchen Kriterien haben Sie diese Berichte ausgewählt bzw. geordnet?
Nun, ich wollte ein möglichst breites Spektrum an menschlichen Schicksalen abbilden: zwei KZ-Häftlinge, eine überlebende Jüdin, ein jüdischer Flüchtling des Jahres 1938, der mit der US-Armee als Sieger zurückkehrte, Menschen, die im Osten Österreichs von der russischen Front überrollt wurden, sich nach Hause durchschlagende Wehrmachtssoldaten, ehemalige Nazis, Nazi-Gegner, Mitläufer, Vertriebene aus dem Sudetenland, Binnenflüchtlinge etc. Die Auswahl geschah intuitiv. Und ich kann sagen, dass ich allein mit dem Material, das ich recherchiert habe und das mir zur Verfügung steht, noch einige Bücher füllen könnte, die bestimmt nicht weniger spannend wären als das vorliegende. Die Anordnung geschah chronologisch, soweit das halt möglich war, ohne den inneren Zusammenhang einer Erzählung zu zerreißen.
Gibt es eine Lebensgeschichte, die Sie persönlich besonders berührt?
Wenn ich so nachdenke, kann ich mich besonders gut mit dem italienischen Maler Aldo Carpi identifizieren. Er war ungefähr so alt, wie ich es heute bin, als er wegen seiner Kontakte zur italienischen Resistenza verhaftet und nach Mauthausen und später ins KZ Gusen verschleppt wurde. Er überlebte, weil die SS-Führer im Lager seine Meisterschaft als Künstler erkannten und sich von ihm porträtieren ließen. Er malte und zeichnete sozusagen um sein Leben. Was mich an Aldo Carpis Geschichte besonders berührt: Irgendwann begann er, täglich heimlich Briefe an seine geliebte Frau daheim in Milano zu schreiben. Natürlich konnte er keinen dieser Brief absenden. Und er riskierte sein Leben, denn es war Häftlingen strengstens verboten, irgendwelche Aufzeichnungen zu machen. Er tat es trotzdem, und so entstand ein faszinierendes Tagebuch, das er bis zur Heimkehr im Sommer 1945 fortführte.


Zerstörtes Wien. Heldenplatz mit Neuer Hofburg und Denkmal für Prinz Eugen. 1945.
© Foto: Votava / brandstaetter images / picturedesk.comSehr erschütternd ist auch der Bericht über Vergewaltigungen durch russische Soldaten in einer Weinviertler Gemeinde. Würden Sie sagen, das ist ein unterbeleuchtetes, weil tabubehaftetes Thema in Zusammenhang mit Kriegsgewalt?
Wenn ich Ihre Frage auf die sexuelle Gewalt in Österreich 1945 eingrenze, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das Thema jemals wirklich ein Tabu gewesen wäre und man nicht darüber gesprochen habe. Mir kommt in diesem Zusammenhang ein Wiener Uni-Professor in den Sinn, der Anfang der 1990er-Jahre in einer Vorlesung im Plauderton sogar davon sprach, dass das Ausmaß der Vergewaltigungen in Ostösterreich in der Öffentlichkeit stark übertrieben wurde. Wer die drastischen Berichte und Ego-Dokumente von 1945 liest, kann eine solche Aussage wirklich nicht begreifen.
Ein Tabu war es für die allermeisten Frauen, die selbst missbraucht und vergewaltigt worden waren, ihre eigenen, persönlichen Erfahrungen zu thematisieren. Aber um das zu verstehen, muss man wahrlich kein Psychologe sein. Bemerkenswert an dem erwähnten Bericht aus der Weinviertler Gemeinde Prottes ist es daher auch, dass viele Frauen nach rund 40 Jahren überhaupt dazu bereit waren, mit dem Autor – ein Sohn des Dorfes, den sie seit seiner Kindheit her kannten – über die selbst erlittene sexuelle Gewalt offen zu sprechen. Dergleichen findet sich selten in der Fachliteratur.
Man kann es vielleicht so sagen: Allgemein waren die Schändungen und Vergewaltigungen immer ein Thema, auch in geschichtlichen Darstellungen. Aber über das selbst erlittene Leid wollten die Opfer in der Regel nicht sprechen. Da gab und gibt es tatsächlich starkes Tabu.


Wiener Heldenplatz
Wir leben heute wieder in unsicheren Zeiten. Können uns diese Berichte aus der Vergangenheit auch als Warnung dienen?
Nun, erstens einmal wollte ich zeigen, wie es damals war, und zwar aus der Perspektive der sogenannten kleinen Leute. Zweitens erzählt das Buch, wie Kriege enden, was mit Menschen passiert, die – unverschuldet oder nicht – zwischen die Fronten, die in ein umkämpftes Niemandsland geraten. Und darin verpackt ist unausgesprochen natürlich auch die Warnung enthalten, es nicht so weit kommen zu lassen. Aber mit einer banalen, allgemein gehaltenen Warnung ist es leider nicht getan.
Wenn es mit banalen Warnungen nicht getan ist, was wäre dann notwendig?
Demokratie ist nicht für die Ewigkeit, man muss täglich an ihr arbeiten. Politische System können sich ändern, Demokratie kann in Autokratismus abgleiten, eine Garantie gibt es nicht. Das heißt einerseits: Wachsamkeit. Andererseits rate ich aber auch zu ein bisschen mehr Gelassenheit. Man sollte tunlichst billigen Alarmismus meiden und keine historischen Parallelen ziehen – zum Beispiel zu den Vorgängen in den 1930er-Jahren –, die einfach nicht stimmen. Und bitte nicht ständig die Nazikeule auspacken. Das ist nutzlos und kontraproduktiv, wie der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg der FPÖ anschaulich zeigt. Aber ich gebe zu, das klingt ebenfalls ein bisschen allgemein und banal. Man kann die Frage wahrscheinlich nur an ganz konkreten Fallbeispielen sinnvoll erörtern.
Wie blicken Sie als Historiker generell auf die aktuellen Entwicklungen – können wir aus der Geschichte etwas lernen?
Na ja, als Beobachter des Weltgeschehens und Zeitgenosse hat man im Laufe eines Lebens ja häufig das Gefühl, dass es genau jetzt, exakt in der Zeit, die man gerade erlebt, besonders schlimm ist. Ich kann nur sagen, so schlimm wie 1945 ist es bei Weitem noch nicht. Aber ich gebe zu, die Ukraine, der Nahe Osten und manch andere Entwicklungen können einem schon schlaflose Nächte bereiten. Natürlich kann man aus Geschehenem, Erlebtem und Erlittenem lernen. Wir machen das jeden Tag. Und zum Glück hat man aus geschichtlichen Vorgängen ja auch wichtige Lehren gezogen, die Fehler der Ersten Republik hat man in Österreich weitgehend vermieden. Das ist unbestreitbar. Aber mein Eindruck ist, dass jede Generation darauf besteht, gewisse Fehler immer und immer wieder zu wiederholen, wenngleich jedes Mal in neuer, veränderter Form. Bei Primo Levi, dem italienischen Schriftsteller und Auschwitz-Überlebenden, heißt es: „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen.“ – Das ist aus meiner Sicht die beste Lehre, die man ziehen kann, und die wichtigste Warnung, auf die man hören sollte.
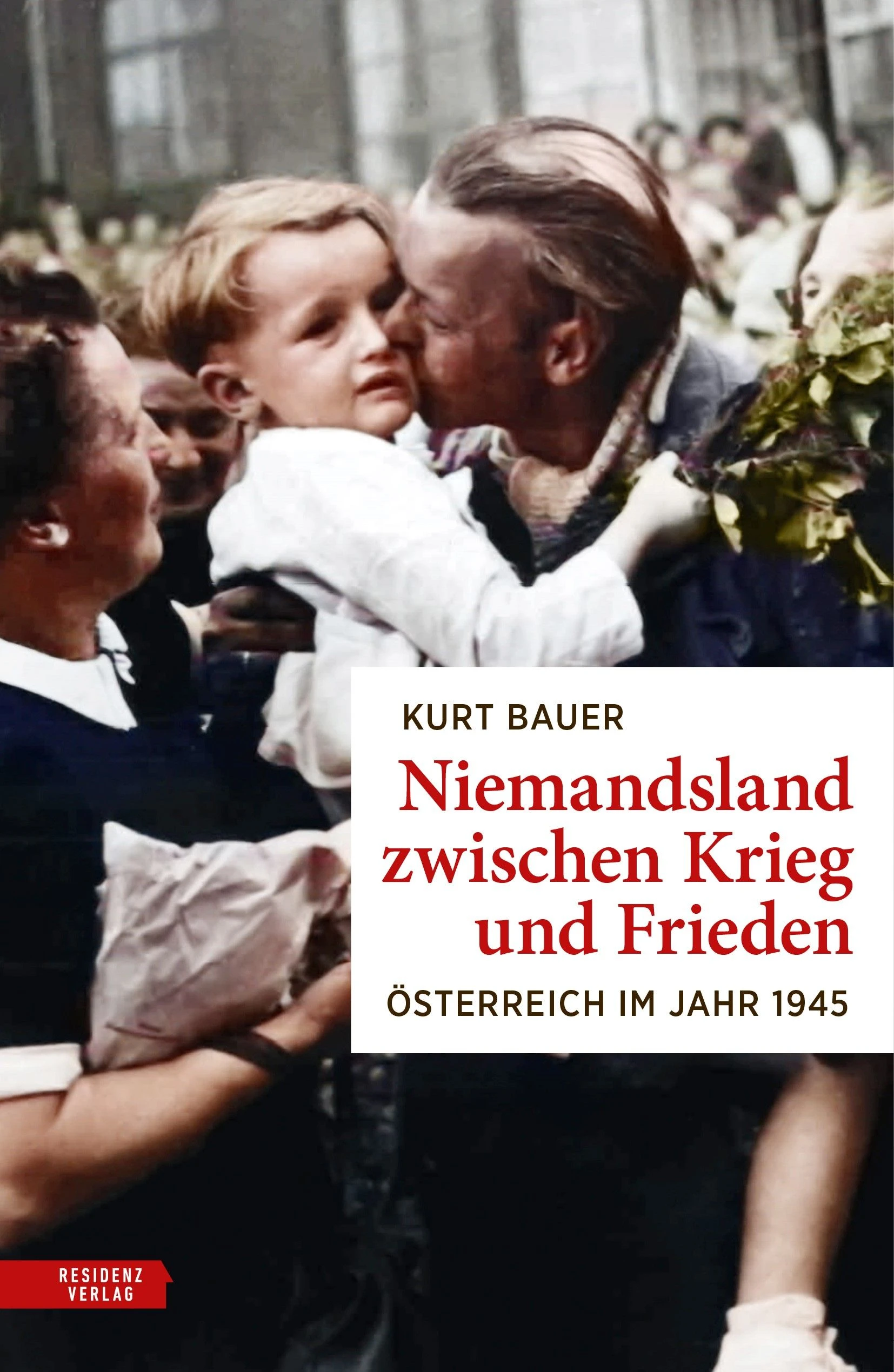
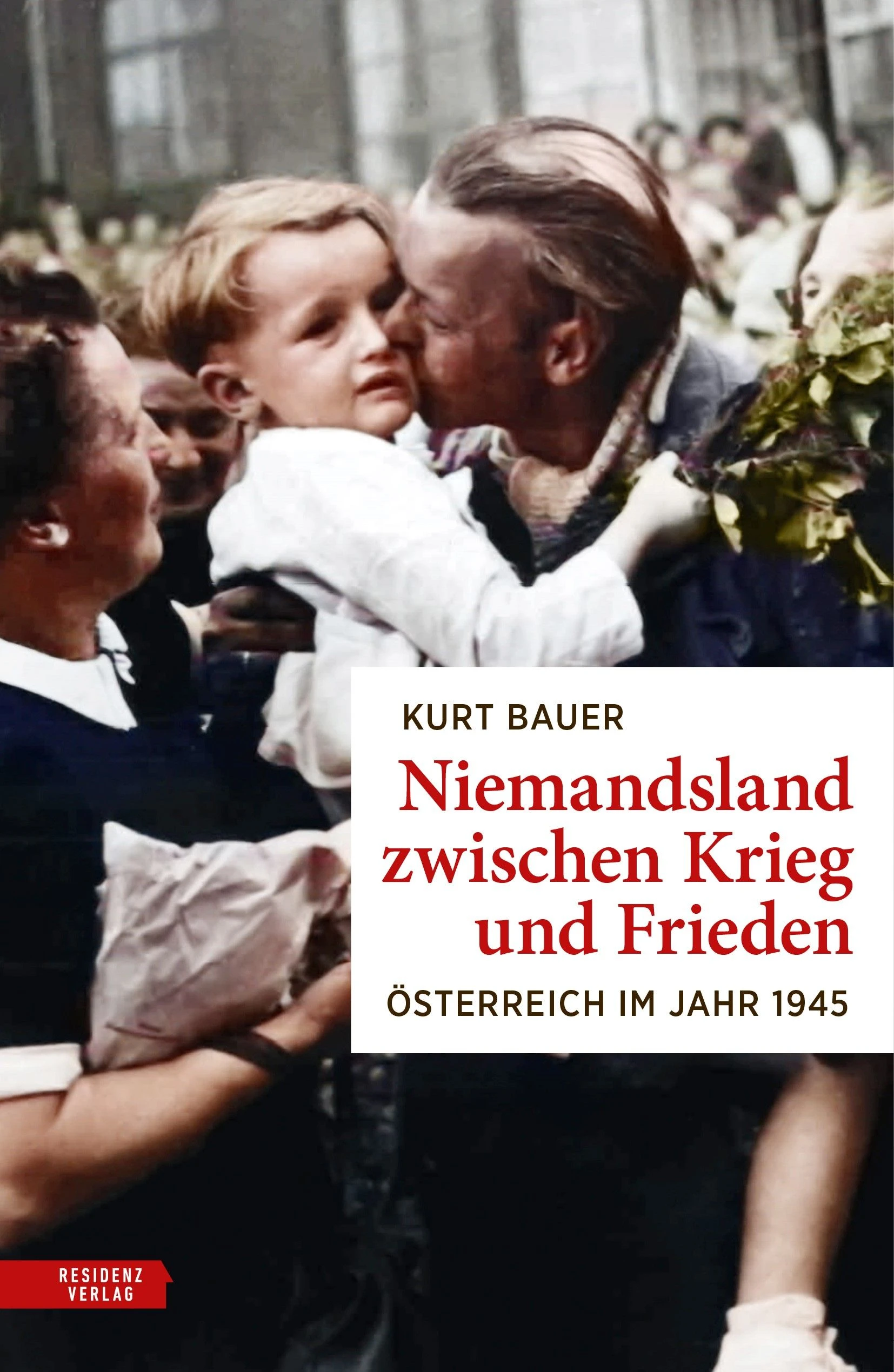
Das Buch
In „Niemandsland zwischen Krieg und Frieden – Österreich im Jahr 1945“ sammelt Kurt Bauer Berichte aus dem Jahr, in dem der Krieg zu Ende ging.
Residenz, € 29
Über Kurt Bauer
Der gelernte Schriftsetzer war viele Jahre als Producer und Verlagslektor, später als freier Historiker tätig. Seit 2019 ist er Mitarbeiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung. Bauer ist Autor der Bücher „Hitlers zweiter Putsch“ (2014), „Die dunklen Jahre“ (2017) sowie „Der Februaraufstand“ (2019)
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 19/25 erschienen.







