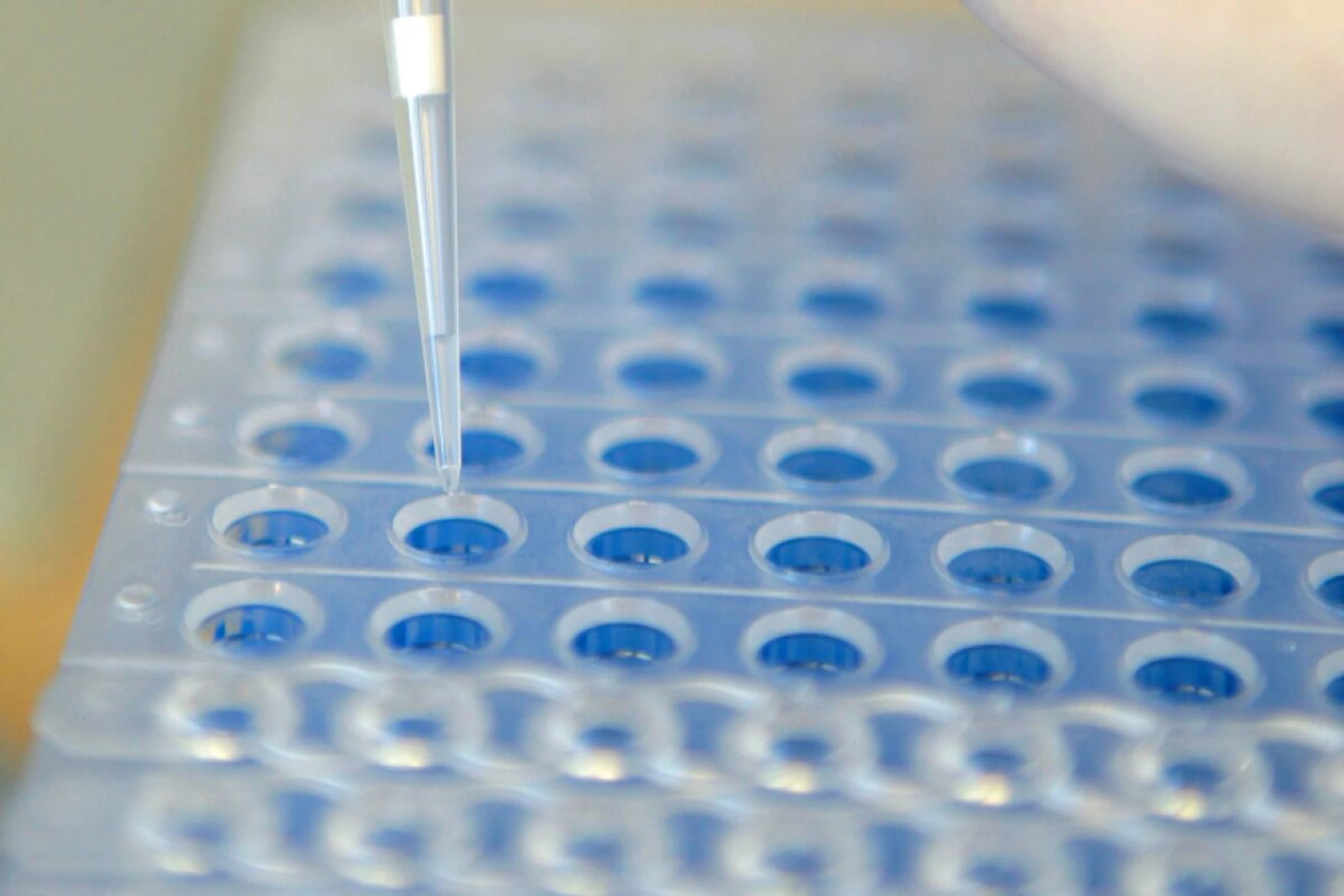Michael J. Fox leidet seit 1991 an Parkinson
©IMAGO / ZUMA Press WireEin US-Forschungsteam hat in den Gehirnen verstorbener Parkinson-Patienten das Pegivirus HPgV entdeckt. Die Ergebnisse deuten auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Virusinfektionen und neurodegenerativen Erkrankungen hin – weitere Studien sind nötig.
Ein internationales Forscherteam rund um Barbara Hanson von der Northwestern University hat in einer im Fachjournal im Fachjournal JCI Insight veröffentlichten Studie Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem humanen Pegivirus (HPgV) und der Parkinson-Erkrankung gefunden.
In den Gehirnen von fünf der zehn verstorbenen Parkinson-Patient:innen, die im Rahmen der Untersuchung analysiert wurden, konnte genetisches Material des HPgV nachgewiesen werden. In der Vergleichsgruppe – 14 ebenfalls verstorbene, alters- und geschlechtsgematchte Personen ohne Parkinson – war das Virus nicht präsent.
Pegivirus bislang als harmlos eingestuft
Das HPgV ist in der Bevölkerung weit verbreitet, galt bisher jedoch als klinisch unauffällig. Die neue Studie wirft nun Fragen zur möglichen Rolle des Virus bei der Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen auf. Begleitende Blutuntersuchungen zeigten, dass Parkinson-Patient:innen mit HPgV-Infektion bestimmte immunologische Merkmale teilten, darunter niedrigere Werte des Entzündungsmarkers IL-4.
Auch genetische Faktoren dürften eine Rolle spielen: So reagierten Patient:innen mit einer bekannten Parkinson-assoziierten Mutation anders auf das Virus als jene ohne genetische Prädisposition.
Viren und Neurodegeneration: Eine breitere Perspektive
Der mögliche Zusammenhang zwischen Virusinfektionen und Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer oder Multipler Sklerose wird seit einigen Jahren intensiv erforscht. So wurde etwa der Epstein-Barr-Virus als Auslöser von MS identifiziert. Andere Viren wie West-Nil-, St.-Louis-Enzephalitis- oder Japanisches-Enzephalitis-B-Virus stehen ebenfalls im Verdacht, Parkinson-ähnliche Symptome hervorrufen zu können.
Ein zentrales Thema dabei ist die Rolle chronischer Entzündungen im Gehirn. Laut Barbara Hanson könnte eine „langanhaltende, unterschwellige Infektion“ eine dieser Entzündungskaskaden auslösen – mit möglichen Langzeitfolgen für das Nervensystem.
Kein Beweis, aber ein neuer Ansatz
Die Studienautoren betonen, dass die Ergebnisse keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen HPgV und Parkinson belegen. Vielmehr handelt es sich um einen statistischen Hinweis, der weitere Forschung notwendig macht. Auch externe Fachleute wie der US-Neurologe Joseph Jankovic plädieren für Folgestudien mit größeren Patientenkohorten, um die Relevanz des Befundes besser einordnen zu können.
Trotz aller Einschränkungen liefert die Studie neue Impulse für ein besseres Verständnis jener Faktoren, die bei der Entstehung von Parkinson eine Rolle spielen könnten – im Zusammenspiel von Genetik, Umwelt und möglicherweise auch viralen Einflüssen.