Dank wissenschaftlicher Fortschritte können Therapien genauer auf bestimmte Personengruppen und sogar auf einzelne Menschen zugeschnitten werden – das hat weitreichende Folgen.
Kein Patient gleicht dem anderen, dennoch werden bei Krankheiten in den meisten Fällen dieselben oder zumindest ähnliche Therapien angewendet. Das soll sich durch personalisierte Medizin ändern. Die Idee dahinter: Genauer auf den einzelnen Menschen und seine – bestehenden oder zukünftigen – Krankheiten eingehen. „Personalisierte Medizin bedeutet, die beste Therapie zum besten Zeitpunkt für die jeweilige Person verfügbar zu haben“, erklärt Renate Kain, Leiterin des Klinischen Instituts für Pathologie von AKH und MedUni Wien.
Patientengruppen können immer weiter eingegrenzt werden
Derzeit sei es nicht möglich, für jeden Einzelnen eine individuelle Therapie durchzuführen, aber es sei möglich, immer kleiner werdende Subgruppen von Patientinnen und Patienten zu schaffen, sagt Kain – sie ist auch Präsidentin der Plattform für Personalisierte Medizin, über die Universitäten und andere Institutionen auf diesem Gebiet vernetzt werden. „Wir grenzen Patientengruppen immer weiter ein und entwickeln mit neuen Biomarkern die prädiktive Diagnostik weiter. Damit sehen wir beispielsweise, ob bestimmte Medikamente in diesem Fall überhaupt sinnvoll sind.“
Es gibt mehrere Gründe, weshalb das möglich ist: So kann dank neuer Biomarker die Diagnostik verfeinert werden; durch Genom-Analysen werden Dosierungen genauer; mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) werden riesige Datenmengen analysiert, um darin Muster und Verläufe zu erkennen, außerdem können mit KI radiologische Bilder und andere Befunde genauer untersucht werden. Österreich gilt weltweit als einer der Vorreiter bei personalisierter Medizin. Dazu trägt unter anderem das in Bau befindliche Eric-Kandel-Institut (Zentrum für Präzisionsmedizin) bei: Auf dem AKH-Campus in Wien soll dabei die Grundlagenforschung in neue Therapien umgesetzt werden.
Was heute schon möglich ist, zeigt sich am Beispiel der Behandlung von Brustkrebs. Dank moderner Diagnostik – sogenannter Liquid Biopsy – könnten Medikamente gezielt bei relevanten Mutationen eingesetzt werden, erläutert Leonhard Müllauer, ebenfalls am Pathologie-Institut der MedUni tätig. „Dadurch kann teils auf Gewebebiopsien verzichtet werden, die belastend und oft gar nicht möglich sind, zum Beispiel bei Knochenmetastasen.“ Diese Liquid Biopsy (auf deutsch Flüssigbiopsie) ist eine minimalinvasive Untersuchung, bei der aus einer Blutprobe oder anderen Körperflüssigkeiten von Tumoren freigesetzte Bestandteile wie zellfreie Tumor-DNA*, zirkulierende Tumorzellen oder Exosomen (winzige Bläschen) analysiert werden – damit lassen sich Hinweise auf Krebs finden.
DNA
Das molekulare „Datenarchiv“ der Zelle, darin sind die Baupläne des Körpers in Formen einer langen Kette aus vier Bausteinen gespeichert (die Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin).
Das bedeutet zugleich, dass auf die Labore mehr Arbeit zukommt. „Labore, die entsprechende Tests durchführen können, unterliegen strengen Auflagen und müssen unter anderem CE-zertifiziert sein“, sagt Kain. Die Ausstattung dieser Labore sei aber kostspielig; außerdem braucht es nicht nur insgesamt mehr Personal für die Diagnostik, sondern auch diverses Personal, etwa Bioinformatiker – das wiederum sei wegen der jetzigen Berufsvorschriften schwierig, weil nicht alle Berufsgruppen zugelassen sind.
Überhaupt sind die Ausgaben ein leidiges Thema, wie generell im Gesundheitswesen. „Wenn niedergelassene Ärzte in Zukunft mehr Proben an Krankenhäuser wie das AKH senden, stellt sich die Frage, wie das Gesundheitssystem diese Kosten stemmen kann und ob es überhaupt darauf vorbereitet ist“, sagt Kain. Doch damit personalisierte Medizin pauschal als zu teuer abzutun, vergisst nicht nur den (leidenden) Menschen, sondern das große Ganze. Kain: „Generell werden die Kosten in Diagnostik und Therapie steigen, aber dadurch können Menschen länger gesund und arbeitsfähig bleiben – das gilt es abzuwägen.“ Für Unternehmen, die in wachsenden Bereichen wie Liquid Biopsy tätig sind, bedeutet das indes Chancen auf mehr Umsätze.
Praktischer Einsatz passiert schon>
Es gibt etliche Beispiele, wie die bisher erzielten Fortschritte in der personalisierten Medizin – manchmal auch als Präzisionsmedizin bezeichnet – bereits in der Behandlung von Patienten eingesetzt werden:
Am AKH Wien wurde vor Kurzem erstmals in Österreich ein Patient mit einer schweren rheumatologischen Autoimmunerkrankung mit eigens hergestellten CAR-T-Zellen behandelt; die eigenen T-Zellen des Patienten wurden dafür im Speziallabor der Universitätsklinik für Transfusionsmedizin und Zelltherapie aufbereitet und anschließend auf der Knochenmarktransplantationsstation verabreicht. Diese CAR-T-Zellen (das steht für „Chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen“) sind körpereigene Abwehrzellen, die im Labor gentechnisch umprogrammiert werden, sodass sie krankhafte Zellen gezielt erkennen und ausschalten. Was ursprünglich für bestimmte Blutkrebserkrankungen entwickelt wurde, kann mittlerweile auch bei schweren Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden. Noch heuer soll dazu eine klinische Studie für therapieresistente Autoimmunerkrankungen eingereicht werden; dabei soll die gesamte Prozesskette von der Zellentnahme über die gentechnische Modifikation bis zur Rückgabe der CAR-T-Zellen in den Körper am AKH Wien und der MedUni Wien durchgeführt werden.
Das Hormon Oxytocin steuert wichtige Körperfunktionen wie Geburt und Stillen, es wird auch als „Liebeshormon“ bezeichnet. Wiener Forscher haben nun entdeckt, dass der sogenannte Oxytocin-Rezeptor eine wichtige Rolle bei Brustkrebs spielen könnte: Dieser kann nämlich als Bio-Marker genutzt werden, um Art und Weiterentwicklung des Tumors zu charakterisieren. Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Studien zeigen, dass Frauen mit Kindern und längeren Stillzeiten seltener an Brustkrebs erkranken – beides Prozesse, bei denen Oxytocin aktiv ist; in Tierversuchen konnte Oxytocin das Tumorwachstum um bis zu 70 Prozent verringern. Besonders hoffnungsvoll ist, dass dieser Oxytocin-Rezeptor zur Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren gehört, auf die schon rund ein Drittel aller verfügbaren Medikamente abzielen.
Die Nutzung genetischer Informationen wie Mutationen ist eine der Grundlagen der personalisierten Medizin. So können durch Technologien wie Next-Generation-Sequencing Millionen von DNA- oder RNA-Fragmenten aus einer einzelnen Probe sequenziert werden – das bedeutet, die genaue Reihenfolge der Bausteine eines Moleküls zu bestimmen, um genetische Informationen zu bekommen. Dazu gibt es hierzulande nun eine eigene Technologieplattform: Die Biomedical Sequencing Facility (BSF) soll dafür sorgen, dass die Genom-Medizin rasch ausgebaut wird.
Next-Generation-Sequencing (NGS)
Ein modernes Verfahren, mit dem viele DNA- oder RNA-Stücke gleichzeitig gelesen werden können, was schnelle und kostengünstige genetische Analysen ermöglicht.
RNA
Das ist eine Arbeitskopie bestimmter DNA-Abschnitte und transportiert die Bauanleitung aus der DNA zu den Zellbausteinen, damit Proteine gebildet und andere Zellprozesse gesteuert werden können.
Sequenzieren
Die Bestimmung der exakten Reihenfolge der Bausteine eines Biomoleküls – bei DNA/RNA die Abfolge der Basen, bei Proteinen die Reihenfolge der Aminosäuren. Das Ergebnis ist die Sequenz, aus der sich unter anderem genetische Informationen für die Diagnostik ableiten lassen.
Die KI hilft Ärzten
Eine Rolle spielt auch Künstliche Intelligenz: So haben Forscher unter Leitung der MedUni Wien ein KI-System entwickelt, das die Diagnose einer Herzkrankheit erleichtert: Bei der Kardialen Amyloidose lagern sich nicht richtig gefaltete Eiweiße im Herzmuskel ab. Unbehandelt kann das zu Herzschwäche und oft zum Tod führen, daher ist eine frühe Diagnose entscheidend. Das KI-System kann nun Szintigrafie-Aufnahmen (ein nuklearmedizinisches Bildgebungsverfahren) entsprechend analysieren – und die KI schneidet dabei mindestens so gut ab wie menschliche Experten und beschleunigt die Diagnostik. Weil zugelassene Therapien zwar den Krankheitsverlauf bremsen, bestehende Ablagerungen aber nicht rückgängig machen, könnte die KI-Auswertung künftig ein breites Screening aller Szintigrafie-Untersuchungen ermöglichen und so frühere, gezieltere Behandlungen unterstützen.
Und deutsche Forscher haben eine Möglichkeit gefunden, wie man Krebsbehandlungen präziser auf einzelne Patienten zuschneiden kann. Bisher nutzen Ärzte einige wenige Parameter wie das Tumorstadium für Therapieentscheidungen – das wird aber der Komplexität von Krebserkrankungen nicht gerecht. Die KI analysiert nun 350 verschiedene Faktoren gleichzeitig, von Laborwerten über Bildgebung bis zu genetischen Daten. Trainiert wurde das System mit Daten von rund 15.000 Patienten mit verschiedenen Tumorarten; es wurde auch bereits erfolgreich an Lungenkrebspatienten getestet.
Besonders wichtig: Dabei erklärt die KI sogar, wie sie zu ihren Therapieempfehlungen kommt. Die Methode soll künftig auch in Akutfällen helfen, bei denen schnelle Diagnosen lebenswichtig sind. Mit Hilfe der KI sollen außerdem seltene Erkrankungen früher erkannt werden, für Patienten werden individuelle Verhaltenspläne – etwa bei Diabetes vom Typ 2 – erstellt und bei Chemotherapien berechnet die KI ganz genau die einzelnen Dosierungen.
Wir werden in Zukunft rascher und viel ausgedehnter analysieren können, dadurch wird es auch mehr Zufallsbefunde geben
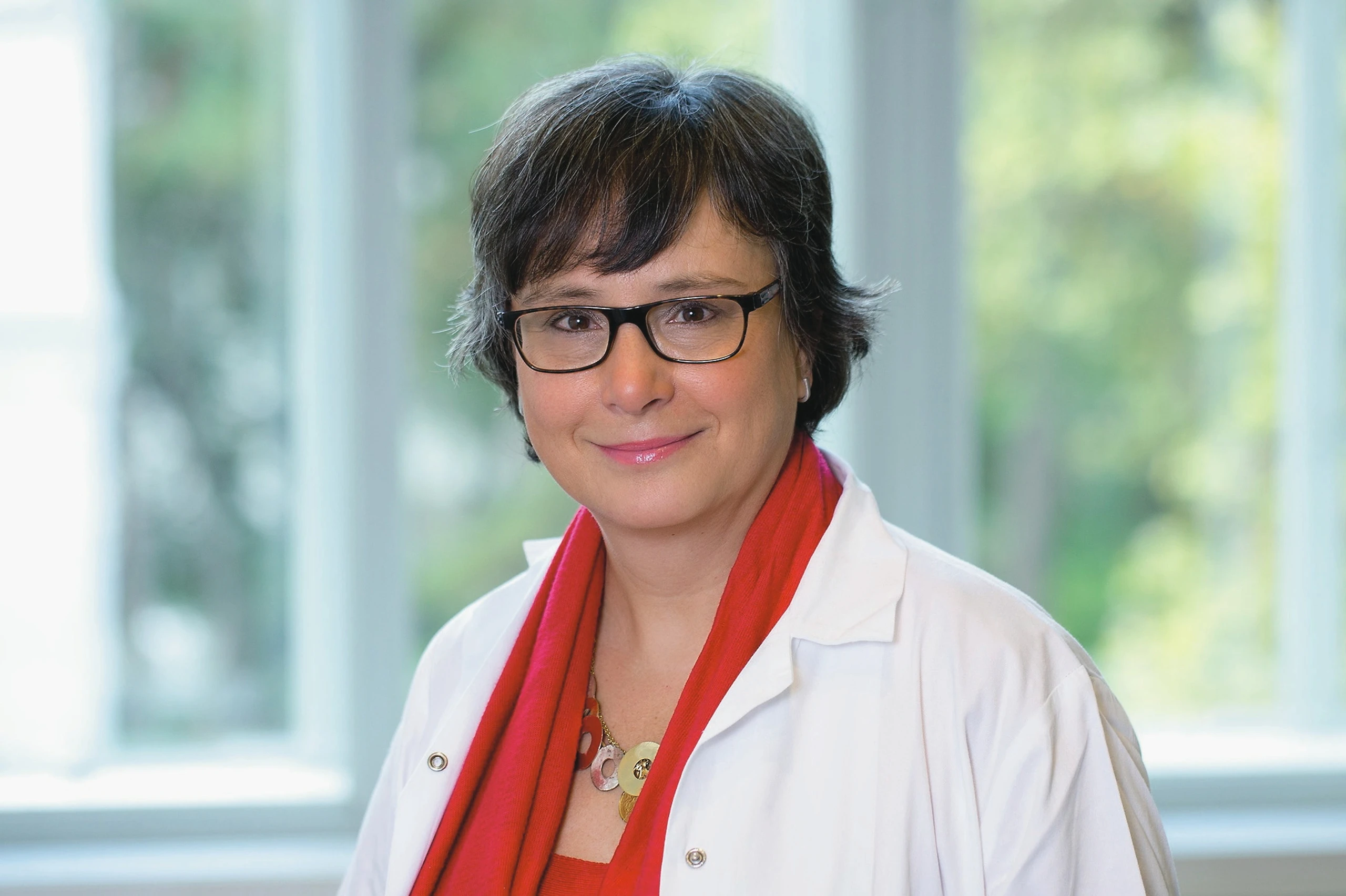
Strenge Vorgaben zum Datenschutz
Die Auswertung von Daten ist also die Grundlage für die meisten Entwicklungen – und daher ist Datenschutz ein wichtiges Thema, wenn Therapien genauer auf bestimmte Personen oder Personengruppen ausgerichtet werden sollen. Schon jetzt gilt: „Beim Umgang mit Daten müssen wir die strengen Vorgaben zu Datenschutz und Gentechnik in Österreich befolgen“, erklärt Kain. Alle Befunde, die die Keimbahn betreffen, seien besonders gut geschützt und nur unter strengen Auflagen zugänglich. „Das ist gut so, andererseits müssen wir unsere IT-Systeme darauf ausrichten.“ Der Zugriff auf Daten muss nach Ansicht von Müllauer generell besser werden, damit beispielsweise in einer Kinderklinik Informationen rasch verfügbar sind. Mehr Analysen bedeutet seiner Ansicht aber auch mehr Chancen, Krankheiten zu entdecken: „Wir werden in Zukunft rascher und viel ausgedehnter analysieren können, dadurch wird es auch mehr Zufallsbefunde geben.“
Die Vision der personalisierten Medizin: Noch intensiver bei jedem einzelnen Menschen schauen, was er wirklich hat und was er in Zukunft haben könnte. „Das große Ziel ist das Screening scheinbar Gesunder, damit können beispielsweise kleine Tumore erkannt werden, auch solche, die nach einer scheinbaren Heilung noch vorhanden sind“, erläutert Müllauer. Hier gelte es aber abzuwägen zwischen Information und Prävention auf der einen Seite und möglicher Panik wegen einer Prädisposition für eine bestimmte Krebsart auf der anderen Seite. Kain meint, dass man alles untersuchen kann, doch nicht für alles gäbe es bereits Therapien. Sie ist aber sicher: „Wir werden immer bessere und zielgerichtetere Therapien entwickeln können.“
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 41/2025 erschienen.






