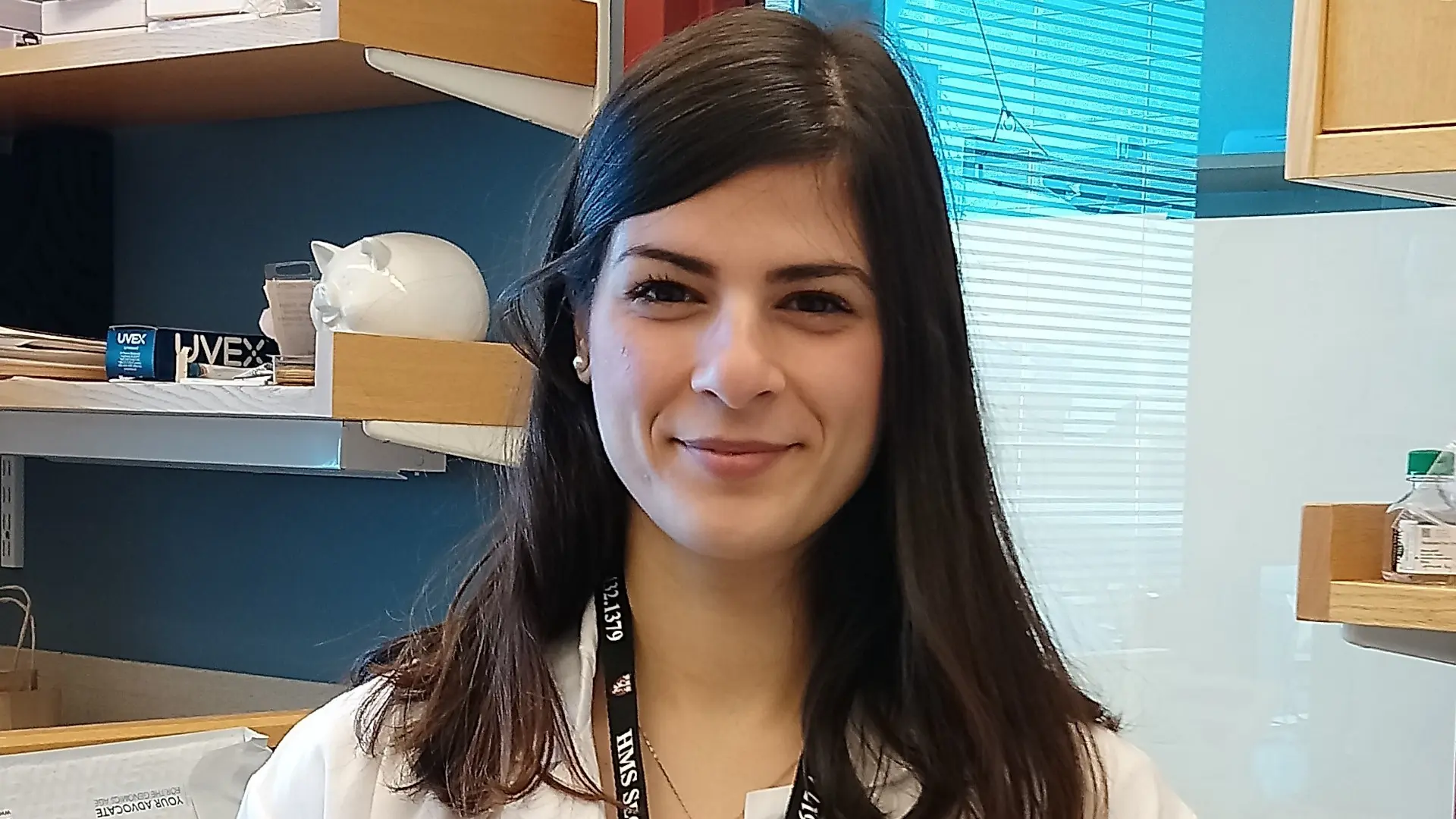Winzige Gehirne aus der Petrischale, riesige Fragen an die Zukunft. Angeliki Spathopoulou züchtet kleine Gehirne, um eine der rätselhaftesten Erkrankungen unserer Zeit zu verstehen. Klingt nach Utopie, ist aber Realität im Labor der Forscherin.
Rund 90.000 Menschen in Österreich sind im Laufe ihres Lebens von Schizophrenie betroffen – einer Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln tiefgreifend verändert. Sie beginnt häufig im jungen Erwachsenenalter, wenn das Leben eigentlich erst Fahrt aufnehmen sollte. Realität und Wahrnehmung geraten aus dem Gleichgewicht, vertraute Gewissheiten lösen sich auf. Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Rückzug und Angst prägen die akuten Phasen. Noch immer ist das Bild davon in der Öffentlichkeit von Missverständnissen und Stigma geprägt: Schizophrenie wird fälschlicherweise mit „gespaltener Persönlichkeit“ gleichgesetzt oder als ein Zeichen von mangelnder Intelligenz missverstanden. Doch beides trifft nicht zu. Es handelt sich um eine neurobiologische Erkrankung, deren Ursachen bislang nur in Ansätzen verstanden sind.
Genau hier setzt die Forschung von Angeliki Spathopoulou an. Die Neurowissenschaftlerin am Institut für Molekularbiologie in Innsbruck arbeitet mit sogenannten Gehirnorganoiden. Das sind winzige im Labor gezüchtete „Mini-Gehirne“, die frühe Entwicklungsprozesse des menschlichen Gehirns nachahmen. Anhand solcher Modelle untersucht sie, wie Schizophrenie auf zellulärer und molekularer Ebene entsteht. Und das lange bevor sich erste Symptome zeigen. Ihr Ziel: die Grundlagen dafür zu schaffen, die Krankheit früher zu erkennen und künftig besser behandeln zu können.
Was hat Ihre Familie dazu gesagt, als Sie das erste Mal erzählt haben, dass Sie mit „Mini-Gehirnen“ forschen?
Meine Familie war schon immer fasziniert und neugierig auf meine Forschung. Die Idee, im Labor Gehirnmodelle zu entwickeln, um menschliche Krankheiten zu untersuchen, klang für sie nach Science-Fiction – aber nachdem ich ihnen den wissenschaftlichen Wert erklärt hatte, waren sie wirklich begeistert.
Sie züchten ja Gehirnorganoide, also winzige Modelle menschlicher Gehirne. Wie muss man sich das vorstellen? Eher Science-Fiction oder Realität?
Es klingt wie Science-Fiction, aber die Verwendung von Gehirnorganoiden wird mittlerweile in vielen Laboren zur Standardtechnik! Wir verwenden Stammzellen, um dreidimensionale Strukturen zu züchten, die die frühe Gehirnentwicklung nachahmen und uns helfen zu verstehen, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren und was bei verschiedenen Krankheiten schiefgeht.
Was war der Moment im Labor, bei dem Sie dachten: Das verändert alles?
Das erste Mal, als ich mit postmortalem menschlichem Hirngewebe arbeitete. Die Erkenntnis, dass jemand sein Gehirn nach dem Tod der Wissenschaft gespendet hatte, war zutiefst bewegend – sie machte mir die Verantwortung bewusst, die wir als Forscher tragen.
Warum gerade Schizophrenie ? Und nicht Alzheimer, Depression oder eine andere Krankheit des Gehirns?
Das menschliche Gehirn hat mich schon immer fasziniert. Während meiner Masterarbeit im Labor von Prof. Yankner an der Harvard University hatte ich die Gelegenheit, mit menschlichen in-vitro-Modellen und postmortalen Hirnproben von Patient:innen mit Schizophrenie und bipolarer Störung zu arbeiten. Mir wurde bewusst, wie wenig wir über diese Erkrankungen wissen, und ich wollte dazu beitragen, dies zu ändern.
Schizophrenie ist eine Krankheit mit biologischen Grundlagen, keine persönliche Entscheidung
Sie erforschen ja eine Krankheit, die das Denken, Fühlen und Handeln verändert. Wie hält man da selbst den Kopf klar?
Natürlich kann es manchmal belastend sein, eine Krankheit zu erforschen, die Menschen so tiefgreifend beeinflusst. Aber ich erinnere mich immer wieder daran, dass uns jede noch so kleine Erkenntnis der Hilfe für die Betroffenen näherbringt – und das motiviert mich.
Viele Menschen verbinden Schizophrenie mit Angst oder Unverständnis. Was möchten Sie, dass wir als Gesellschaft besser verstehen?
Schizophrenie ist eine Krankheit mit biologischen Grundlagen, keine persönliche Entscheidung. Es gibt deutliche molekulare und zelluläre Veränderungen im Gehirn der Betroffenen, und die Erkenntnis dieser Tatsache ist wesentlich, um das Stigma abzubauen und Empathie zu fördern.
Sie sind in Griechenland geboren, haben in Deutschland und den USA geforscht und leben jetzt in Innsbruck. Was treibt Sie an? Neugier, Ehrgeiz oder ein bisschen Wahnsinn im besten Sinne?
Vermutlich eine Mischung aus allen dreien! Neugierde treibt mich an, schwierige Fragen zu stellen, Ehrgeiz hält mich am Laufen, und eine Prise „Wahnsinn“ gehört dazu und hilft mir, riskante neue Ideen zu planen.
Harvard Medical School, Marie Curie-Stipendium, jetzt der L’Oréal-UNESCO-Preis – klingt nach einer steilen Karriere. Hatten Sie irgendwann das Gefühl: Jetzt hab ich’s geschafft?
Es ist immer ein langer Weg! Die Wissenschaft lehrt einen stets Demut und jede Entdeckung wirft zehn neue Fragen auf. Doch ich nehme mir manchmal einen Moment Zeit, um zu würdigen, wie weit ich schon gekommen bin und wer mir dabei geholfen hat, insbesondere mein Ph.D.-Mentor Prof. Dr. Edenhofer.
Sie arbeiten täglich mit Gehirnzellen – was haben Sie über das menschliche Denken gelernt, das man im Alltag anwenden könnte?
Komplexität und Gleichgewicht sind alles. Das Gehirn funktioniert am besten, wenn die verschiedenen Bereiche gut miteinander kommunizieren – und vielleicht gilt das auch für das Leben.
Sie haben Pharmazie studiert, dann Biochemie und jetzt forschen Sie an Schizophrenie. War das ein Plan oder eher ein Zufall mit Folgen?
Es gab keinen festen Plan. Jeder Schritt öffnete eine neue Tür – von der Pharmazie über das Verständnis von Molekülen und Biochemie bis hin zur Neurowissenschaft. Rückblickend hat mich jeder einzelne Schritt auf diesem Weg zu der Wissenschaftlerin geformt, die ich heute bin.
Wir müssen Umgebungen schaffen, in denen Frauen erkennen, dass die Wissenschaft nicht nur intellektuelle Freiheit, sondern auch langfristige Stabilität und Unterstützung bietet
Nur etwa jede vierte Person in Österreichs Forschung ist eine Frau. Warum ist das 2025 noch immer so?
Frauen stehen nach wie vor besonderen Herausforderungen, insbesondere wenn es darum geht, Familie und wissenschaftliche Karriere zu vereinbaren. Zudem mangelt es an sichtbaren Vorbildern – etwas, das sich ändern muss.
Was müsste passieren, damit mehr junge Frauen in Laboren statt in Meetingsälen sitzen wollen?
Wir müssen Umgebungen schaffen, in denen Frauen erkennen, dass die Wissenschaft nicht nur intellektuelle Freiheit, sondern auch langfristige Stabilität und Unterstützung bietet. Mentoring und Repräsentation sind dabei entscheidend.
Und ehrlich: Wie oft zweifeln Sie an Ihrer Forschung – und wie oft glauben Sie, wirklich auf der Spur einer großen Entdeckung zu sein?
Zweifel gehören zum Prozess. Es gibt schwierige Tage, aber wenn ein Experiment gelingt oder Ergebnisse Sinn ergeben, ist dieses Gefühl der Entdeckung unvergleichlich.
Woran arbeiten Sie im Moment ganz konkret?
Ich untersuche mithilfe von induzierten Neuronen und Gehirnorganoiden, die von eineiigen Zwillingen stammen, wie epigenetische Faktoren zur Pathologie der Schizophrenie beitragen.
Wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen – was möchten Sie dann erreicht haben?
Ich hoffe, meine Forschung wird dazu beitragen, die molekularen Grundlagen der Schizophrenie besser zu verstehen, um die Basis für eine frühere Diagnose und effektivere Behandlung zu schaffen. Persönlich möchte ich eine eigene Forschungsgruppe gründen und mich als Wissenschaftlerin und Mentor weiterentwickeln.
Wenn Sie nicht im Labor stehen – wie sieht Ihr Alltag aus?
Das akademische Leben ist ziemlich anspruchsvoll, aber ich versuche, abzuschalten. Ich liebe Spaziergänge in der Natur, Lesen und Filme schauen. Das hilft mir, neue Energie zu tanken und die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen.
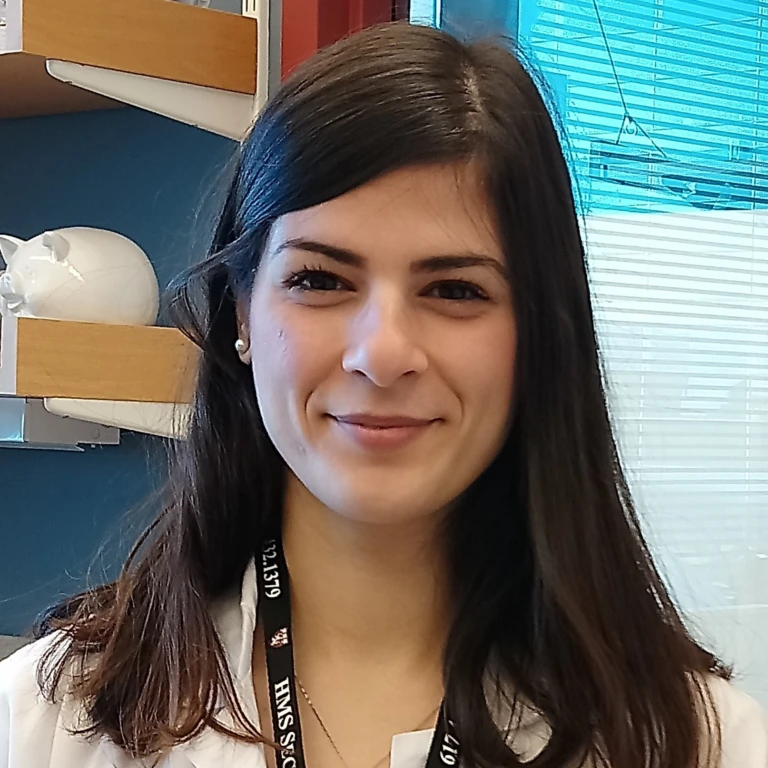
Steckbrief
Angeliki Spathopoulou
Angeliki Spathopoulou, geboren 1992 in Griechenland, absolvierte ein Pharmazie-Studium in Thessaloniki, forschte in Bonn und an der Harvard Medical School und promovierte in Innsbruck als Marie-Skodowska-Curie-Stipendiatin. Für ihre wissenschaftliche Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Prof.-Ernst-Brandl-Forschungspreis und dem L’Oréal-UNESCO For Women in Science Award.