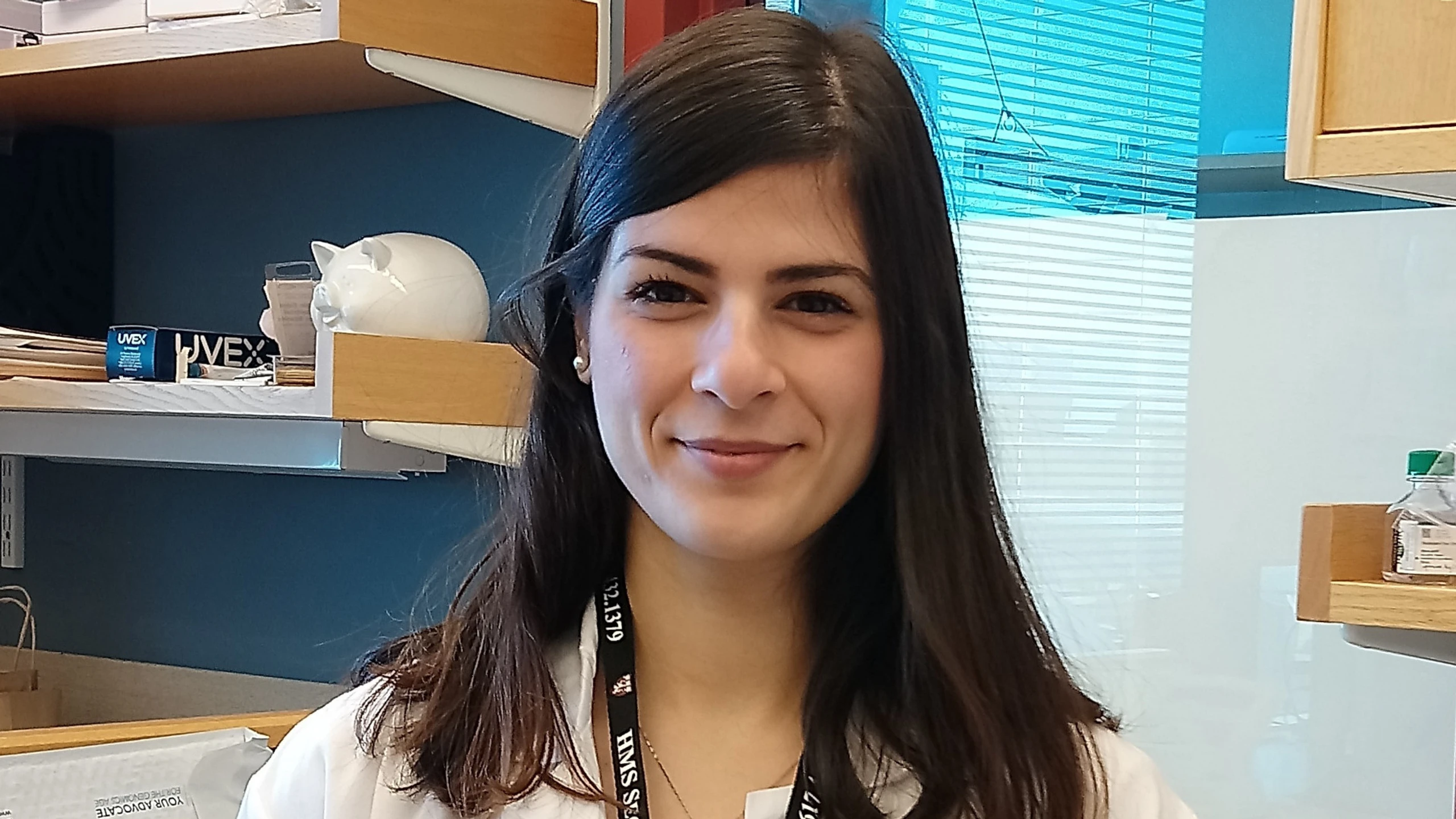Je eifriger die Generäle, desto nötiger die Philosophen. Der Deutsche Richard David Precht, 60, albern als „Pop-Star“ seiner Wissenschaft tituliert, wirft kühle Blicke auf die überhitzende Welt. Im Traktat „Angststillstand“ thematisiert er den Verlust der Meinungsfreiheit durch Einschüchterung im Namen der Korrektheit. Im News-Gespräch blickt er über die Krisenherde der Zeit.
Herr Precht, wir haben zuletzt im Juni 2024 telefoniert. Trump war noch nicht gewählt, und Sie hielten die Bedrohung des Westens durch Putin für überschaubar. Wie stellt sich die Situation denn jetzt dar?
Ich glaube nicht, dass ich damals so falsch lag. Wir haben nach der Regierungsübernahme durch Trump immer noch eine NATO. Daran wird sich nichts ändern. Und Russland beabsichtigt nach wie vor nicht, westeuropäische Länder anzugreifen.
Aber die Kriegsrhetorik steigt.
Ja, die NATO und Russland trauen einander mittlerweile alles zu. Wir sind wie vor dem Ersten Weltkrieg in eine psychologisch gefährliche Situation gekommen. Von Abrüstung oder Diplomatie ist auf beiden Seiten nicht mehr die Rede. Es scheint nur noch einen Lösungsweg zu geben, der in der Aufrüstung liegt. Dabei sagt der gesunde Menschenverstand, dass das nur immer mehr Benzin über das Problem gießt.
Die Drohnen fliegen jedenfalls schon.
Da gibt es sehr viel Nebel. Über die Drohnen, die am Münchner Flughafen gesichtet worden sein sollen, wissen wir gar nichts. Die Drohnen, die in Bremerhaven den Hafen ausspioniert haben sollen, scheinen mir ebenfalls eine trübe Angelegenheit zu sein. Warum sollten die Russen den Hafen ausspähen? Das kann ich auch mit Google Earth, oder ich schicke einen als Hafenarbeiter verkleideten Agenten. Und wenn Flugzeuge über die Grenze fliegen, kann es auch sein, dass sie sich verflogen haben. Leider sind wir in der psychologischen Verfassung, dass wir Russland derzeit alles zutrauen.
Die Bedrohung ist also geringer, als allseits angenommen wird?
Nicht unbedingt. Die drei Jahre Ukraine-Krieg enthalten die gefährliche Botschaft, dass es in Europa einen langwierigen Krieg geben kann, ohne dass Atomwaffen eingesetzt werden. Noch vor wenigen Jahren haben wir geglaubt, dass eine auch indirekte Konfrontation Russlands mit der NATO unweigerlich in einen Atomkrieg führt. Jetzt sind Spekulationen geweckt, dass man auch dauerhaft ein bisschen Krieg führen kann. Der moderne Krieg ist in erster Linie ein Krieg mit Drohnen. Damit ist die Gefahr gestiegen, dass durch wechselseitige Zündelei ein Krieg wie ein Computerspiel ablaufen kann. Die nennen wir es „Vergamisierung“ des Kriegs führt auf beiden Seiten zu gefährlichem Leichtsinn.
Aber wie ist es so weit gekommen?
Über lange Zeit haben sich die Russen von der NATO nicht ernst genommen gefühlt. Die Ost-Erweiterung wurde konsequent fortgesetzt, ohne sich durch den russischen Protest erschüttern zu lassen. Auch die EU hat dem nicht widersprochen und sich die Russen, die uns lange die Hand ausgestreckt hatten, zu Feinden gemacht. Inzwischen werden die Europäer von den Russen tatsächlich als Feinde angesehen.
Halten Sie einen Krieg für möglich?
Ja.
Warum?
Wenn man so gewaltig aufrüstet, besteht immer die Gefahr, dass davon auch irgendwann etwas eingesetzt wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn die deutsche Regierung mehr diplomatische Anstrengungen unternähme, mit Putin zu reden. Wir bräuchten eine KSZE 2.0, eine gemeinsame Konferenz, die sich die Frage stellt, wie Europa in zehn Jahren aussehen soll. Da sollen beide Seiten realistische Wünsche äußern, wie sie sich eine stabile Nachkriegsordnung vorstellen können, in der einander nicht weiterhin zwei Blöcke bedrohen.
Und Österreich? Die Neutralität steht bei der Außenministerin ja nicht hoch im Kurs.
Ich sehe Österreich von Putin nicht bedroht. Was immer Putins Fantasien, Ressentiments und Aggressionen sein mögen, gegen Österreich richten sie sich nicht. Österreich ist aber nicht das einzige Land, das sich damit wichtig macht, sich als Hauptkriegsbeute von Putin zu sehen. Ein anderes Beispiel wäre Dänemark, obwohl es nicht den geringsten Hinweis gibt, dass Putin von der Eroberung Dänemarks träumt.
Aber die Drohnen sind doch dort aufgetaucht, nicht?
Offensichtlich, weil Dänemark innerhalb der NATO zu den schärfsten Antagonisten Russlands zählt.


Das Buch
Die Meinung zu sagen, ist gefährlich. Schon mehr als 50 Prozent der befragten Deutschen sind dieser Meinung und in Österreich dürfte es nicht anders sein. Im Traktat „Angststillstand“ thematisiert Richard David Precht die Korrektheitszensur.
Goldmann, 21,50 Euro
Dann kommen wir zum aggressiven Rückbau der Meinungsfreiheit. Gehen die Errungenschaften der Siebzigerjahre tatsächlich verloren?
Zunächst muss ich sagen, dass die größten diesbezüglichen Veränderungen in der westlichen Welt nicht von den Regierungen ausgehen, Trump ausgenommen. Die größte Bedrohung der Meinungsfreiheit ist die Verletzlichkeit des anderen. Unsere Gesellschaften sind emotionaler geworden, sensibler in Gerechtigkeitsfragen. Wir sind individueller geworden und verlangen ein viel höheres Maß Aufmerksamkeit für uns, als es der Kleinbürger in den Fünfzigerjahren getan hat. Das ist positiv, aber der Nachteil ist: Wir sind im gleichen Maße, wie wir emotionaler geworden sind, auch empfindsamer geworden.
Nennen wir es gleich wehleidiger und beleidigter?
Das ist die Folge. Wer empfindsam ist, ist leicht beleidigt und wehleidig. Ich würde sogar sagen, wir werden nicht mehr erwachsen. Der Prozess des Erwachsenwerdens bedeutet ja, resilienter zu werden, sich ein dickeres Fell zuzulegen. Inzwischen aber benehmen sich Erwachsene wie Kinder. Das ist eine Infantilisierung der Gesellschaft, oder, wie ich es nenne, eine Axolotlisierung. Nach dem mexikanischen Salamander, der in seinem Gewässer die Entwicklung einstellt.
Wenn sich alle ständig angegriffen fühlen, kann eine liberale Demokratie nicht mehr funktionieren. Laut Umfragen ist weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung noch der Ansicht ist, dass man seine Meinung äußern kann, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Das ist erschreckend. Die Politik thematisiert immer nur die eine Seite, die Pöbelei im Netz, die Angriffe auf Politiker und andere Menschen, die Hemmungslosigkeit in den sozialen Netzwerken. Sie sieht aber nicht die Gegenseite: dass sich heute Linke und Rechte über alles aufregen, und dass diese Aufregungskultur gefährlich für den Fortbestand der Demokratie ist.
Aber die sozialen Medien sind ja tatsächlich der Brunnen des Bösen.
Aber auch die Möglichkeit, sich alternativ zu informieren.
Alternativ ist ein gutes Stichwort. Hätte man die Meinungsfreiheit in der Corona-Zeit nicht eingeschränkt, wären wir heute ein Lazarett. Wo muss man denn da eingreifen?
Das Problem ist, dass der, der da reguliert, egal, ob eine nationale Regierung oder die Europäische Union, einerseits Schiedsrichter ist und andererseits Partei. Es gibt Meinungen, die von der Regierung als korrekt oder nicht schlimm empfunden werden, und andere, die als wahnsinnig schlimm empfunden werden. Aber wer entscheidet das? Wenn ein Donald Trump das Internet regiert, werden andere Sachen verboten, als wenn es ein linksgrüner Politiker tut.
Nun gibt es die interessante Entwicklung, dass sich Rechtsparteien wie die FPÖ den traditionellen Medien verweigern, selbst Fernsehsender machen und alles auf die sozialen Medien verlagern. Wie sollen denn wir traditionellen darauf reagieren?
Nehmen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es wäre wichtig, dass er das gesamte Meinungsspektrum repräsentiert. Davon geht die Welt nicht unter. Wir haben in Deutschland in den 70er-, 80er-Jahren einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Gabriele Krone-Schmalz gehabt, die sehr weit links von der jeweiligen Regierung stand. Wenn dann Gerhard Löwenthal das ZDF-Magazin präsentierte, wusste man, das ist eine rechte Sendung. Heute repräsentiert man nur noch einen Ausschnitt von dem, was man für die Mitte hält. Und das führt natürlich dazu, dass Leute, die sich nicht zu dieser Mitte zählen, ihre Zuflucht in soziale Netzwerke nehmen müssen. Das gilt auch für alle anderen Leitmedien.
Wie stehen Sie zum Verbot von AfD und FPÖ?
Die österreichische Diskussion kenne ich nicht. Aber ein Verbot der AfD? Da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Dass Nazis innerhalb der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ist völlig richtig. Aber dass man eine gesamte Partei, die im Augenblick bei Umfragen die stärkste ist, verbieten möchte, weil man ihr eine Nazi-Gesinnung unterstellt, die nur relativ wenige ihrer Mitglieder wirklich haben, ist unvorstellbar. Sehr viele AfD-Mitglieder sind eher paläolibertär, man misstraut dem Staat im Allgemeinen und hat Vorstellungen wie Donald Trump.
Tun Sie sich auch mit dem Linkssein immer schwerer?
Was ist links? Eine Partei, die sich vehement für die Aufrüstung einsetzt wie die deutschen Grünen mit Sicherheit nicht. Und unsere ehemalige SPD-Innenministerin, Frau Faeser, die mit ihrem Demokratiefördergesetz die Leute dazu anstiften wollte, verdächtige Meinungen bei Ämtern zu melden und mit der Förderung von Vereinen Spitzeldienste zu belohnen, sicher auch nicht. Was dichtete Ernst Jandl: „Manche meine rinks und lechts kann man nicht velwechsern. Werch ein Illtum.“
Es ist nicht unsere Aufgabe, gegenüber Künstlern eine Gesinnungsprüfung durchzuführen, ob sie die Welt genauso sehen wie wir
Dann lassen Sie uns zur Herzensmaterie kommen, der Kunst. Der Druck erst auf russische und jetzt auf israelische Künstler steigt ständig. In Belgien wird schon ein Münchner Orchester hinausgeworfen, weil sich der israelische Chefdirigent nicht ausreichend von Netanjahu distanziert haben soll. Was tun?
Das ist das Gleiche, was man in Deutschland mit russischen Künstlern wie Netrebko gemacht hat. Ich halte das eine für so falsch wie das andere. Es ist nicht unsere Aufgabe, gegenüber Künstlern eine Gesinnungsprüfung durchzuführen, ob sie die Welt genauso sehen wie wir.
Und die antisemitischen Aufmärsche unter dem Titel des Anti-Israelismus?
Da muss man aufpassen. Wir dürfen die beiden Begriffe nicht miteinander vermengen. Nicht jede Kritik am Staat Israel, sei sie noch so vehement vorgebracht, ist Antisemitismus. Antisemitismus ist ein rassistischer Angriff auf jüdische Menschen. Und Anti-Israelismus ist eine Kritik an der Politik des Staates Israel. Es gibt viele jüdische Menschen, die die Regierung Netanjahu massiv kritisieren. Die sind doch wohl keine Antisemiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass auf Demonstrationen eine wabernde Übereinstimmung der Emotionen stattfindet. Dass Israelkritik und Antisemitismus ineinander übergehen.
Was ist denn ein Imagoge, den Sie im Buch benennen?
Nun, früher hatten wir Ideologen, die haben uns geschlossene Erzählungen darüber präsentiert, was der Mensch ist, was er sein soll und wie er zu leben hat. Und heute haben wir Imagogen: Leute, die Bilder und damit Vorstellungswelten produzieren. Darüber funktioniert auch ein großer Teil der Politik, die mit sehr wenigen, sehr primitiven Metaphern und Bildern arbeitet. Das funktioniert wie in der Werbung, wo der Cowboy durch die Prärie reitet, um den Geschmack von Freiheit und Abenteuer mit einer Zigarette zu symbolisieren, den man dieser Zigarette sicher nicht entnehmen kann.
Jetzt sind es einfache Bilder vom russischen Dracula Putin oder pauschal idealisierende von den Menschen in der Ukraine oder den Palästinensern. Wer die besten Bilder liefert, gewinnt. Trump ist ein solcher Imagoge. Er bietet ja keine Ideologie an, keine geschlossene Weltanschauung, hinter der drei dicke, 600-seitige Bücher wie das „Kapital“ von Marx stehen. Der Stoff, aus dem die politischen Träume sind, sind die Launen eines Narzissten. Auf dieses Niveau ist die Politik inzwischen abgesunken.
Aber es bleibt in Erinnerung, dass Trump möglicherweise schafft, wozu die Biden-Administration offensichtlich nicht willens oder in der Lage war
Aber Trump hat nun die erste Stufe seines Gaza-Friedensplans durchgesetzt. Wird dadurch gar sein negatives Gesamtbild revidiert?
Noch wissen wir nicht, wie stabil der Frieden in Nahost tatsächlich ist, aber es bleibt in Erinnerung, dass Trump möglicherweise schafft, wozu die Biden-Administration offensichtlich nicht willens oder in der Lage war.
Dann kommen wir zur Kunst zurück, die nie so beengt wie heute war, wie Sie schreiben. Wie kam das?
Es gab eine Zeit, da hat man von avancierter Kunst, egal, ob sie Malerei, Film, Literatur, Theater oder was auch immer war, das Aufsprengen der kulturellen Norm einer Gesellschaft erwartet, auch mit den Mitteln der Parodie, der Übertreibung. Das geht heute überhaupt nicht mehr. Die Kunst ist der unfreieste Raum in unserer Gesellschaft. Der ganze Kulturbetrieb besteht aus ängstlichen Menschen, weil dort am üppigsten die Wokeness blüht. Wer eine Ausstellung oder ein Theaterstück macht, muss im vorauseilenden Gehorsam alles ganz, ganz genau überprüfen, damit anschließend nicht jemand beleidigt ist, sich übergangen fühlen, irgendetwas sexistisch oder rassistisch finden kann.
Aber warum betreibt das so maßgeblich die Linke?
Weil sie den Kulturbetrieb regiert. Er ist linksgrün, was ich „sogenannt links“ nenne, und hat die Macht, in seinem Rahmen seine eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Was diesen Vorstellungen widerspricht, wird ausgegrenzt. Ich könnte auf vehementeste Art und Weise Kunst gegen die AfD machen und würde dafür Preise gewinnen. Wenn ich aber eine Kunst mache, die sich zum Beispiel gegen die Wokeness-Kultur richtet, ist das das Ende meiner Karriere.
Sie nennen das läppische Winnetou-Kinderbuch, das mit Karl May kaum etwas zu tun hatte und vom Verlag in Panik aus dem Verkehr gezogen wurde, weil sich ein paar Figuren aufgeregt haben.
Vielleicht 100 Leute waren das, hinter deren Empörung sich ein Mangel an Bildung offenbart, den man sich gar nicht vorstellen kann. Ich bin kein Freund davon, Werke komplett ihrer Historizität zu entkleiden. Man hätte ja auch ein kleines Vorwort schreiben können, wer Karl May war und welche Vorstellung er vom Wilden Westen hatte. Und dann hätte man das gleiche Buch machen können. Was erzählt die Bibel denn über die Philister? Über die Ägypter? Stimmt das wirklich alles im Detail? Wir können doch historische Kulturprodukte keinem Wahrheitstest unterwerfen! Was ich übrigens nie verstanden habe, ist die Kritik am Wort Indianer. Es ist weder eine Beleidigung noch ein Schimpfwort. Es bedeutet nichts anderes als „Gottes Volk“, in dio! Als Kolumbus in Amerika gelandet war, versuchte er herauszufinden, wer diese Leute sind, und sie haben irgendwie mit Händen und Füßen geantwortet: „Wir sind Gottes eingeborenes Volk. Indios.“ Das hat mit Indien überhaupt nichts zu tun …
… wobei ich auch darin keine Beleidigung erblicken kann.
Richtig, und die Native Americans vereinigen sich bis heute im Indian Council. Nur wir dürfen das in einem Kinderbuch nicht mehr verwenden. Es ist gruselig, dass es Menschen gibt, deren Berufsziel oder Lebenspassion es ist, ihre moralische Überheblichkeit an allen Ecken und Enden ausspielen zu müssen. Und der Ravensburger Verlag hätte über die nicht mal 100 Leute, die sich aufgeregt haben, lachen können. Bei Corona haben sich Millionen aufgeregt, und man hat gesagt, ihr habt trotzdem unrecht. Und hier kriecht ein ganzer Verlag zu Kreuze. Um das Buch ist es nicht schade, aber wenn Verlagsleiter, Ausstellungsmacher, Intendanten usw. bei jeder Gelegenheit einknicken, entsteht der von mir diagnostizierte Angststillstand, und die Meinungsfreiheit schwindet mit großen gesellschaftlichen Folgen.
Wurde tatsächlich von der Humboldt-Universität der Vortrag einer Professorin abgesagt, weil sie meint, dass es nur zwei Geschlechter gibt?
Richtig. Es gibt Menschen, die sehen das anders, und andere sehen das so, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Das werden die allermeisten sein, und das dürfen die auch. Warum auf einmal nicht mehr? Wer maßt sich an, das zu bestimmen? Es gibt Dinge, die wir aus guten Gründen auch juristisch nicht tolerieren: Beleidigungen, Verunglimpfungen, Volksverhetzung. Aber die Sichtweise, dass es nur zwei Geschlechter gibt, gehört bestimmt nicht dazu. Wieso müssen wir über die Rechtsprechung hinaus noch einen moralischen Kodex einführen, an den sich jeder zu halten hat? Das ist Machtmissbrauch.
Und profitieren …
… werden am Ende die Rechten! Ist das, was da von sogenannt Linksgrün aus dem Sack gelassen wurde, mit Shitstorm und Cancel Culture, einmal in der Welt, lässt es sich wunderbar auch von der Gegenseite gebrauchen. Das erleben wir im Augenblick in den USA. Und wenn wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nächstens eine Regierung mit AfD-Beteiligung kriegen, bekommen wir die gleichen Mittel unter umgekehrten Vorzeichen von rechts. Jetzt gibt es Universitäten in Deutschland, wo man ein ziemliches Problem hat, wenn man nicht gendert. Wenn die Rechten an die Regierung kommen, werden diejenigen, die gendern, ein großes Problem haben. Und das eine ist so schlimm wie das andere.

Steckbrief
Richard David Precht
Richard David Precht, geboren am 8. Dezember 1964 in Solingen (Deutschland), ist einer der international einflussreichsten Philosophen. Nach dem Roman „Die Kosmonauten“ und dem Tierrechts-Traktat „Noahs Erbe“ schrieb er den Spiegel-Besteller „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“, dem zahlreiche philosophischer und gesellschaftstheoretischer Thematik folgten. Er stand bisweilen im Zentrum heftiger Debatten. Precht ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und Moderator der Talkshow „Precht“ im ZDF. Er ist geschieden und hat einen Sohn. Er lebt in Düsseldorf.
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 42/25 erschienen.