Der Schweizer Martin Suter erreicht seit mehr als 25 Jahren ein Millionenpublikum. Am 11. September stellt er im Wiener Konzerthaus seinen jüngsten Roman „Wut und Liebe“ vor. Ein Gespräch über Rache, Marketing, Künstliche Intelligenz, Intoleranz gegenüber Rechts und Schreiben in düsteren Zeiten.
von
Noah ist Mitte dreißig, Künstler und mittellos. Seine Gefährtin Camille verlässt ihn, weil sie das gemeinsame Leben nicht mehr finanzieren will. Als Noah endlich eine Chance sieht, mit einer Installation im Kunstmarkt wahrgenommen zu werden, stiehlt ihm sein bester Freund die Idee dafür. Seine letzte Hoffnung bleibt die wohlhabende Witwe Betty. Sie verspricht ihm eine beträchtliche Summe, wenn er den Geschäftspartner ihres verstorbenen Mannes beseitigt.
Dieses Setting mutet auf einen ersten Blick wie der ideale Ausgangspunkt für einen Thriller an. Das ist es auch. Doch mit schlichter Spannungsliteratur würde sich der Schweizer Martin Suter, 77, nicht zufriedengeben. Sein jüngster Roman „Wut und Liebe“ verblüfft auf 304 Seiten als furioses Vexierspiel mit überraschenden Wendungen.
Am 11. September stellt Suter seinen Roman mit Burgschauspielerin Caroline Peters im Wiener Konzerthaus vor. Zuvor erreichte ihn News in Zürich.
Herr Suter, Sie stellen Ihren Roman mit Caroline Peters inszeniert im Konzerthaus vor. Ist das Ihr erster Schritt in Richtung Theater? Werden Sie jetzt auch Stücke schreiben und darin sogar selbst mitspielen?
Ich bin kein Schauspieler und habe auch nicht vor, einer zu werden. Ich habe in Wien Caroline Peters an meiner Seite. Mit ihr werde ich die Dialoge lesen. Joachim Lux, er war hier in Wien lange Chefdramaturg am Burgtheater, hat die Dialogfassung geschrieben. Mir gefällt sehr gut, was er gemacht hat und das will etwas heißen, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Schriftsteller so etwas sagt, wenn ein Dramaturg etwas umschreibt.
In „Wut und Liebe“ blicken Sie tief in menschliche Abgründe. Es geht um Rache, Betrug und Geldwäsche. Hat Sie ein bestimmter Fall zu dieser Geschichte inspiriert?
Ich gehe nicht so vor, dass ich auf eine Inspiration hoffe, sonst käme ich nicht voran. Wenn ich nach einer Geschichte suche, dann schaue ich, welche klassisch dramaturgischen Prinzipien und welche Gattungen infrage kommen. „Wut und Liebe“ ist eigentlich ein Gerechtigkeitsund Rache-Roman. Meine Art, über ein Westernthema zu schreiben. Jemand tut jemandem Unrecht und der rächt sich.
Sind Sie schon jemandem begegnet, der sich von seiner Lust auf Rache antreiben ließ?
Ich versuche nicht, mich in andere Leute reinzuversetzen, aber irgendwo in mir sitzt auch ein winziger Rächer und den lasse ich dann größer werden, wenn ich ihn zum Schreiben brauche.
Im Roman schildern Sie verschiedene Rachemotive. Ein Rächer ist ein Künstler, dem eine Idee gestohlen wurde. Ist Ihnen das auch schon passiert?
Das ist mir noch nie passiert. Aber einst hat mir einer meine erste Frau ausgespannt. Da hatte ich schon Rachegelüste.
Haben Sie sich gerächt?
Ich dachte, dem zahle ich es heim. Aber wir waren dann später wieder sehr gut befreundet. Alle drei.
Kehrte die Frau zu Ihnen zurück?
Nein, nein. Die ging weg. Aber sie ist immer noch eine gute Freundin. Sie ist eine sehr erfolgreiche Künstlerin geworden. Vivian Suter.
Ein Künstler im Roman behauptet, wenn man etwas nur für die Welt macht, dann ist es Marketing, wenn man etwas für sich selbst und die Welt macht, dann kann es Kunst werden. Wo sehen Sie die Grenze zwischen Kunst und Marketing?
Das war eine ernste, aber auch spielerische Diskussion von Noah und seinem erfolgreichen Künstlerfreund. Der sagt, man muss den Künstler in seinem Werk erkennen, man muss erkennen, von wem eine Arbeit ist. Denn dieser Noah probiert ständig Stile aus. Ich würde die Grenze dort ansetzen, wo man sich zuerst überlegt, welche Marke man aus sich selbst machen will. Wenn die Kunst per se zur Marke wird, ist das okay. Aber den umgekehrten Weg einzuschlagen, was sicher viele machen, finde ich dubios.
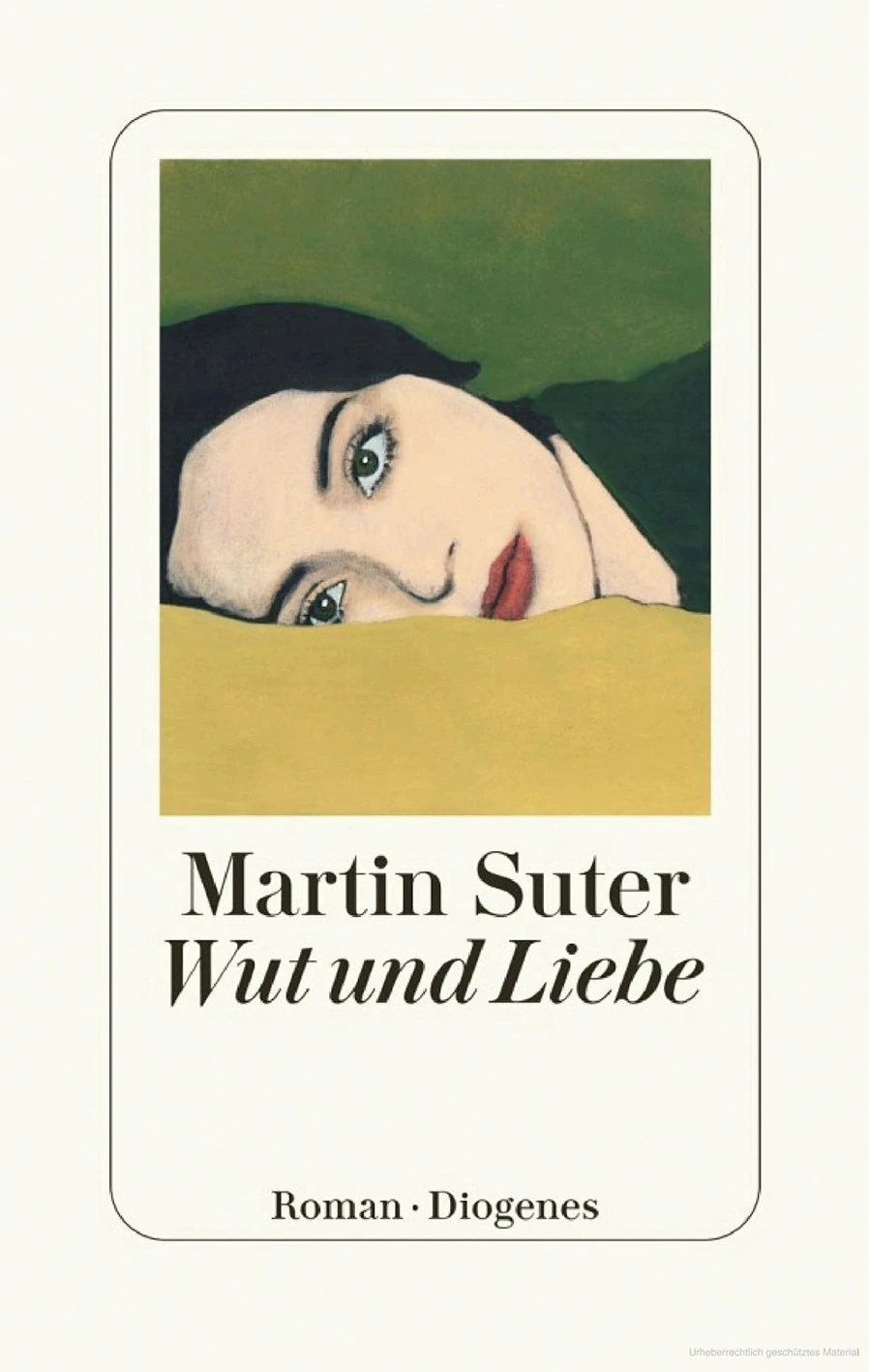
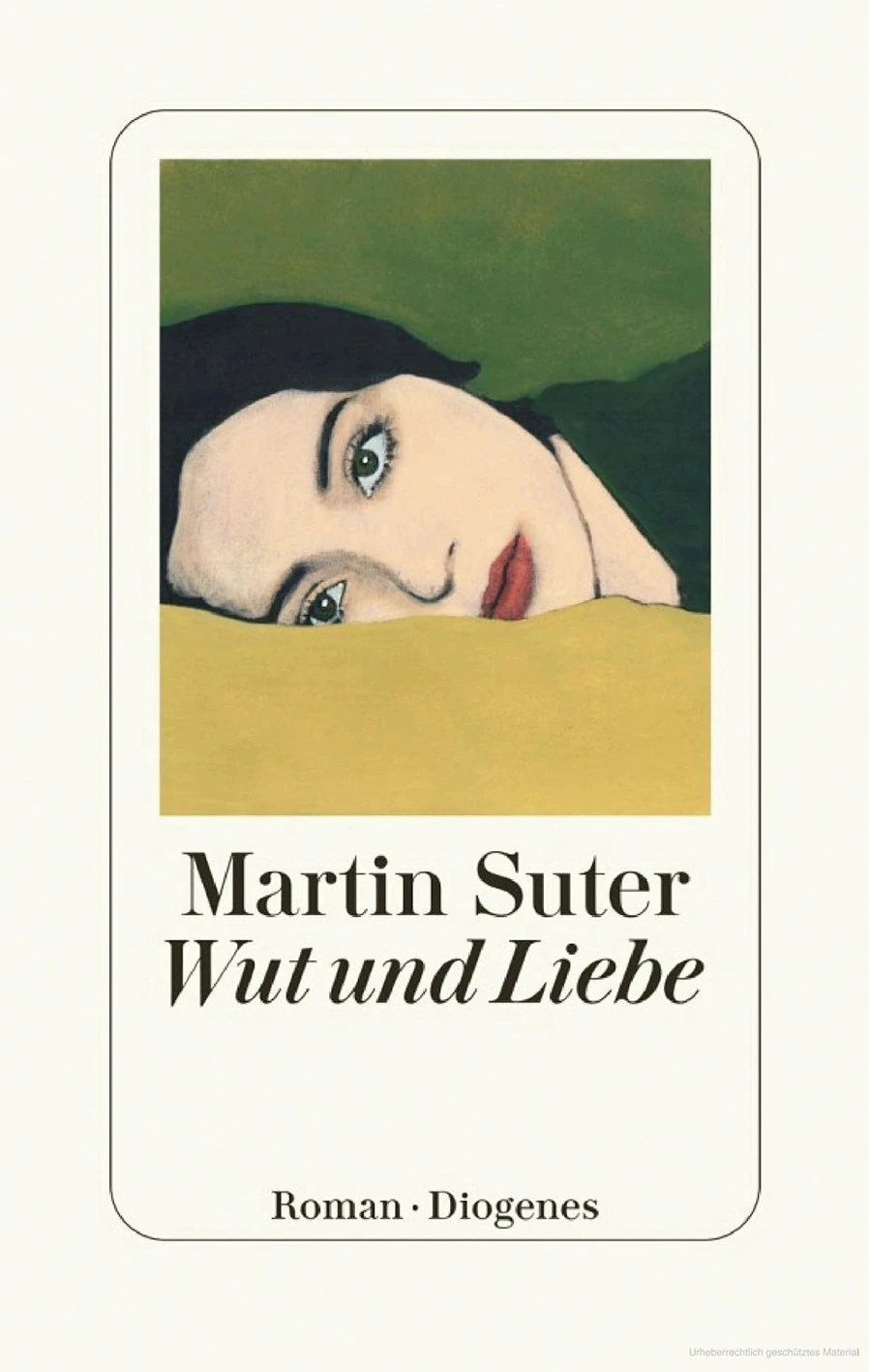
Buch und Lesung
Ein furioser Blick in menschliche Abgründe – „Wut und LIebe“ von Martin Suter. Diogenes, € 26,80
Für seine Lesung am 11. September 2025 im Wiener Konzerthaus mit Burgschauspielerin Caroline Peters ließ Suter seinen Roman von Joachim Lux adaptieren.
Ihr Name wurde über die Jahre zu einer Marke.
Also ich mache etwas Altmodisches. Ich will Geschichten erzählen, weil ich schon als Kind immer gerne Geschichten gehört habe. Ich will Geschichten erzählen, die ich auch gerne selbst lesen würde. Das ist eigentlich mein Marketingkonzept. Dann ist es nur noch Glückssache, wenn man diesen Geschichtengeschmack mit möglichst vielen Leuten teilt, und das ist natürlich wunderbar. Wissen Sie, als ich Werber war, war die Werbung eine sehr unexakte Wissenschaft. Die Art von Werbung, die wir machten, war Unterhaltung. Wer die Menschen am besten unterhält, hat die meisten Chancen, wahrgenommen zu werden. Das war unser Konzept.
Jetzt unterhalten Sie mit Ihren Geschichten ein Millionenpublikum.
Ich glaube, Unterhaltung ist im Feuilleton etwas Abschätziges. Wenn man sagt, das ist Unterhaltung, dann heißt das, es sei keine richtige Literatur, weil richtige Literatur dürfe nicht unterhalten. Aber die große Literatur hat in den meisten Fällen immer unterhalten. Ich mache keine Zwölftonmusik und auch keinen Free Jazz. Ich halte mich an gewisse Regeln wie Komponisten früher. Diese Regeln sind für mich, dass ich mich nicht von einer Geschichte führen lasse. Ich muss der Chef in der Geschichte sein. Bevor ich anfange, muss ich wissen, wie sie ausgeht. Sonst kann ich sie nicht richtig schreiben. Meine Geschichten muss man schieben und ziehen. Dann muss ich auch darüberstehen, weil ich bin der Einzige, der weiß, wohin ich gehe. Das ist nicht Marketing, sondern die Art, wie ich eine Geschichte haben will. Auch als Leser.
Was sehen Sie als Ihr Markenzeichen?
Ich schreibe immer andere Bücher. In der Bildenden Kunst wäre das wahrscheinlich ein Marketingfehler, oder? Wenn ich mal eine naturalistische Kurve zeichne und dann wieder abstrakte, konstruktivistische Sachen. Als ganz junger Mann habe ich mir gedacht, ich will jetzt Schriftsteller werden. Ich fragte mich: Was ist mein Stil? Dann war ich eine Zeit lang an der Uni als Hörer in einem Seminar. Und dann habe ich plötzlich erkannt, ich darf mich nicht so intensiv mit Brecht befassen, weil dann fange ich an zu schreiben wie der. Zum Glück habe ich erst in einem hohen Alter begonnen zu schreiben. Kürzlich hat irgendeine Artificial Intelligence beschlossen, Suter – das bedeutet kurze Sätze. Aber die hatte einen Wortschatz verwendet, den ich überhaupt nicht habe.
Wenn die Neutralität von anderen nicht respektiert würde, dann muss man sich schon irgendwie wehren
<b><i></b></i>
Worüber würden Sie heute in einer von Kriegen überschatteten Zeit nicht schreiben?
Ich bin schon vorsichtig, aber nicht nur in Bezug auf die Kriege. Es gab früher eine starke Bewegung in der Schweiz zur Abschaffung der Armee. Da gab es auch mal eine Abstimmung, die erstaunliche Zahlen hervorgebracht hat. Da weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das aus voller Brust wieder machen würde. Man glaubte an ein „nie mehr Krieg“, und daran kann man leider nicht mehr glauben.
Aber die Schweiz ist ja neutral, wie Österreich, also da kann man doch schon für Frieden schaffen ohne Waffen sein?
Das schon, aber in der Schweiz und in Österreich gibt es die bewaffnete Neutralität. Wenn die Neutralität von anderen nicht respektiert würde, dann muss man sich schon irgendwie wehren. Man kann dann nicht einfach resignieren. Aber das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich finde es furchtbar, wie viele Millionen junger, hoffnungsvoller Menschen einfach geopfert wurden für die für mich völlig unverständlichen Motive einer winzigen Minderheit oder sogar eines einzigen Menschen.
Wirken sich diese düsteren Zustände auch auf Ihr Schreiben aus?
Ich bin ein guter Verdränger. Ich muss meinen Beruf, meine Geschichten von der Welt und dem Leben trennen. Stellen Sie sich vor, meine Frau war krank, sie ist gestorben. Ich könnte gar nicht mehr schreiben, wenn ich jetzt nur dem nachhängen würde. Ich muss das akzeptieren, und ich muss auch akzeptieren, dass ich gerne lebe, dass ich das Leben, dass ich meinen Beruf genieße.
Außerdem haben Sie eine Tochter, die Sie braucht.
Auch wenn sie es nicht vielleicht so gerne hört. Ich brauche sie auch. Dieses Brauchen ist gegenseitig.
Ist Schreiben für Sie Zuflucht oder gar eine Art von Lebensrettung?
Nein. Schreiben soll nichts Therapeutisches haben, weder für mich noch für meine Leserschaft. Schreiben ist für mich, interessante Geschichten schön zu erzählen. Das war einmal verpönt.
Lassen Sie uns noch kurz bei den aktuellen Zeitumständen bleiben. In Österreich gibt es immer mehr Fälle von Antisemitismus. Wie ist das in der Schweiz?
Ja, das gibt es in der Schweiz auch. In der Schweiz gibt es ja ungefähr alles, was es sonst in der Welt gibt. Natürlich gibt es auch den Rechtsextremismus und eine Spaltung der Gesellschaft.
Alice Weidel, die Chefin der rechtsextremen AfD, lebt in der Schweiz. Wie wird sie wahrgenommen?
Gemischt. Von rechts wird sie so wahrgenommen wie überall von rechts. Aber in der Schweiz gibt es eine Reserviertheit oder Diskretion gegenüber Prominenz, die kenne ich selbst. Alice Weidel ist halt leider prominent. Es gibt da eine Toleranz, die nicht immer erfreulich ist.
Wie weit soll Toleranz gegenüber Leuten wie den Rechten gehen?
Also ich bin da intolerant. Wenn ich es auch auf Wienerisch sagen darf, ich würde die nicht einmal ignorieren.
Wie ist das, wenn Sie nach Österreich kommen, da gibt es nicht wirklich eine Diskretion gegenüber sehr bekannten Menschen. Können Sie in Wien ungestört ins Kaffeehaus gehen?
In Deutschland werde ich mehr angesprochen, aber das stört mich eigentlich nie. Es gibt aber auch ein unausgesprochenes Erkanntwerden. Wenn etwa ein großes Foto von mir in einer Zeitung erschienen ist, schaut man mich auch in der Schweiz anders an, aber man schaut dann auch schnell weg, weil man ja nicht einer sein will, der sich beeindrucken lässt von so etwas, oder? Dann gibt es die, die einfach guten Tag sagen und lächeln und ich sage auch guten Tag. Ein bisschen Prominenz, wenn es darum geht, einen Tisch in einem Restaurant zu bekommen, schadet nicht.
Martin Suter
Martin Suter wurde am 29. Februar 1948 als Sohn eines Ingenieurs in Zürich geboren. Mit 26 Jahren wurde er Creative Director der Werbeagentur GGK, gründete eine eigene Agentur und wurde Präsident des Art Directors Club in der Schweiz. In den Neunzigerjahren zog er sich aus dem Werbebusiness zurück und begann zu schreiben.
Sein erster Roman, „Small World“, verschaffte ihm einen Platz auf den Bestsellerlisten. 2011 begann er eine Krimiserie mit dem Gentleman-Gauner Allmen als Ermittler. 2022 fertigte André Schäfer die Dokumentation „Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit“. Der Autor betreibt seine eigene Website martin-suter.com. Er lebt mit seiner Tochter in Zürich.
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr.35/2025 erschienen.






