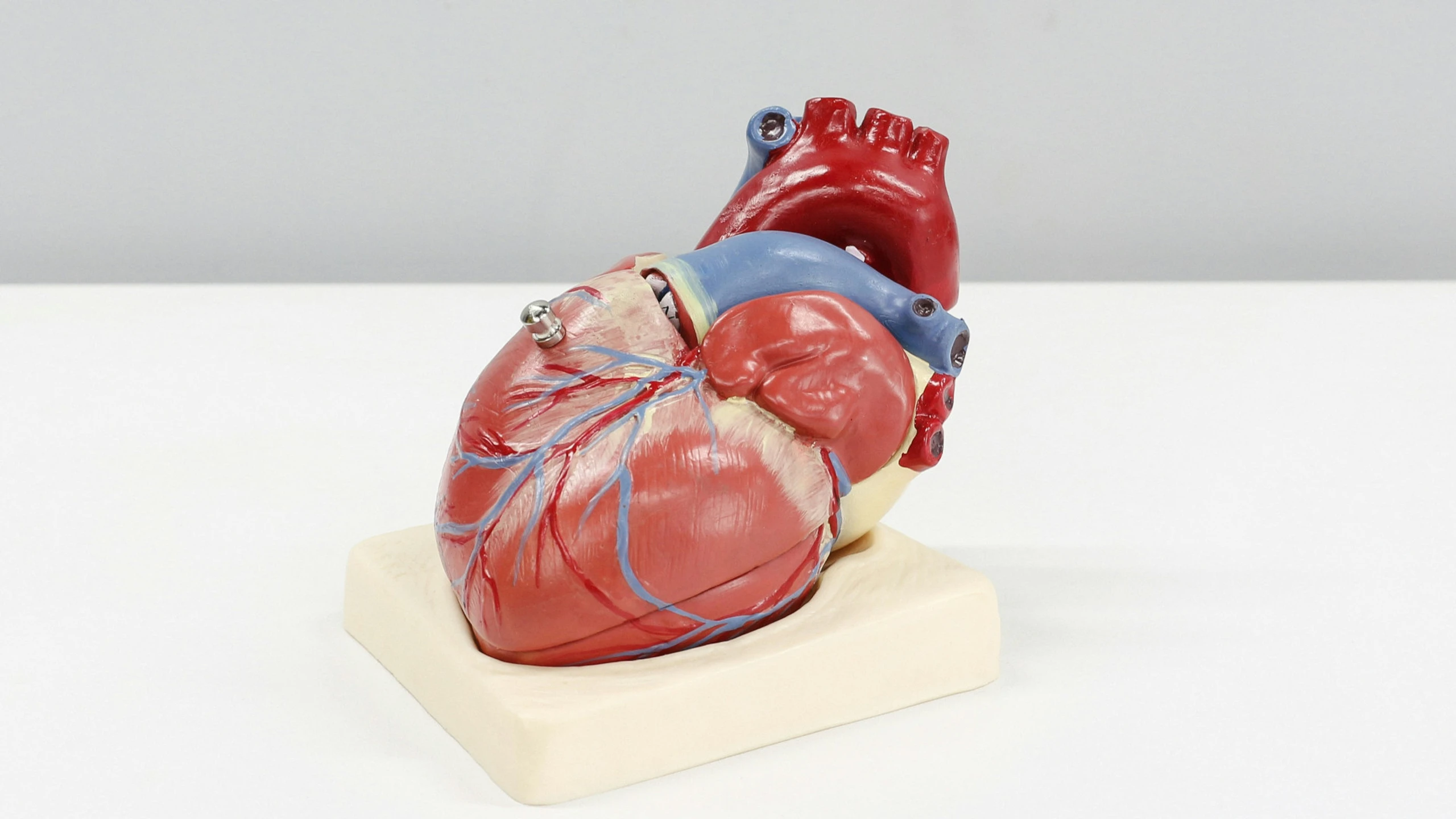Ein Team der Harvard University hat ein tragbares, weiches Exoskelett vorgestellt, das mit Hilfe von maschinellem Lernen Bewegungen von Schlaganfall- und ALS-Patienten individuell unterstützt. Erste Tests zeigen deutliche Fortschritte bei alltäglichen Handlungen.
Forscherinnen und Forscher der Harvard University haben ein tragbares, weiches Exoskelett entwickelt, das Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit der Arme – etwa nach einem Schlaganfall oder mit der Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) – unterstützen soll. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten alltägliche Verrichtungen wie Zähneputzen, Essen oder Kämmen wieder zu ermöglichen.
Das System besteht aus einer mit Sensoren ausgestatteten Weste, in die ein aufblasbarer Luftsack integriert ist. Dieser liegt unter dem Arm und kann sich gezielt aufblasen und entleeren, um die Bewegungen der Nutzerinnen und Nutzer zu unterstützen.
Maschinelles Lernen für individuelle Bewegungsmuster
Eine zentrale Neuerung ist der Einsatz eines maschinellen Lernmodells, das die individuellen Bewegungsmuster der jeweiligen Person erfasst. Über Sensoren, die sowohl Bewegung als auch Druck registrieren, passt das System die Unterstützungsleistung laufend an. Dadurch soll das Exoskelett natürlicher wirken und präzisere Hilfe bei Bewegungen wie dem Anheben oder Senken des Arms bieten.
Frühere Versionen des Geräts konnten zwar Bewegungen unterstützen, jedoch hatten viele Anwender Schwierigkeiten, ihre Arme wieder abzusenken, da ihnen dafür die Restkraft fehlte. Durch die Kombination des neuen Lernmodells mit einem physikbasierten Modell, das den minimal notwendigen Unterstützungsdruck berechnet, konnte dieses Problem reduziert werden.
Klinische Tests
Das Team um den Ingenieurwissenschaftler Conor Walsh testete das System gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten des Massachusetts General Hospital und der Harvard Medical School an neun Freiwilligen – fünf Schlaganfall-Patienten sowie vier Personen mit ALS.
Für die Ärztin Sabrina Paganoni, die als Spezialistin für ALS an der Studie beteiligt war, ist vor allem die Anpassungsfähigkeit entscheidend: „Für Menschen mit ALS sind die wichtigsten Kriterien Komfort, einfache Anwendung und die Fähigkeit des Geräts, sich an die spezifischen Bewegungsmuster anzupassen.“
Auch Patientin Kate Nycz, die seit 2018 mit einer ALS-Diagnose lebt, konnte das Exoskelett mehrfach testen. Sie schildert ihre Alltagseinschränkungen deutlich: „Mein Arm kommt vielleicht auf 90 Grad, dann ermüdet er und fällt wieder. Essen oder wiederholte Bewegungen mit meiner rechten Hand, die früher dominant war, sind schwer.“ Über das Gerät sagt sie: „Ich bin überzeugt, dass dieser Roboter helfen kann, die Lebensqualität von Menschen mit ALS zu verbessern.“
Ergebnisse der Studie
Das Exoskelett konnte die Schulterbewegungen der Nutzerinnen und Nutzer mit einer Genauigkeit von 94 Prozent nachvollziehen. Gleichzeitig verringerte sich die benötigte Kraft beim Absenken des Arms um rund ein Drittel. Zudem verbesserten sich die Bewegungsumfänge von Schulter, Ellbogen und Handgelenk. Nutzerinnen und Nutzer mussten ihren Körper weniger kompensatorisch einsetzen, wodurch die Abläufe präziser und effizienter wurden.
Perspektive für den Alltag
Das Exoskelett könnte sowohl rehabilitative Zwecke erfüllen – etwa bei Schlaganfallpatienten mit Aussicht auf Bewegungserholung – als auch rein unterstützende Funktionen übernehmen, wie im Fall von ALS, wo die Erkrankung fortschreitend verläuft. „Personalisierung ist entscheidend, um die funktionale Selbstständigkeit und Lebensqualität zu erhöhen“, betont Paganoni.
Langfristig strebt das Forschungsteam eine Nutzung im häuslichen Umfeld an. Die Ergebnisse der aktuellen Tests wurden in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht. (as/pte)