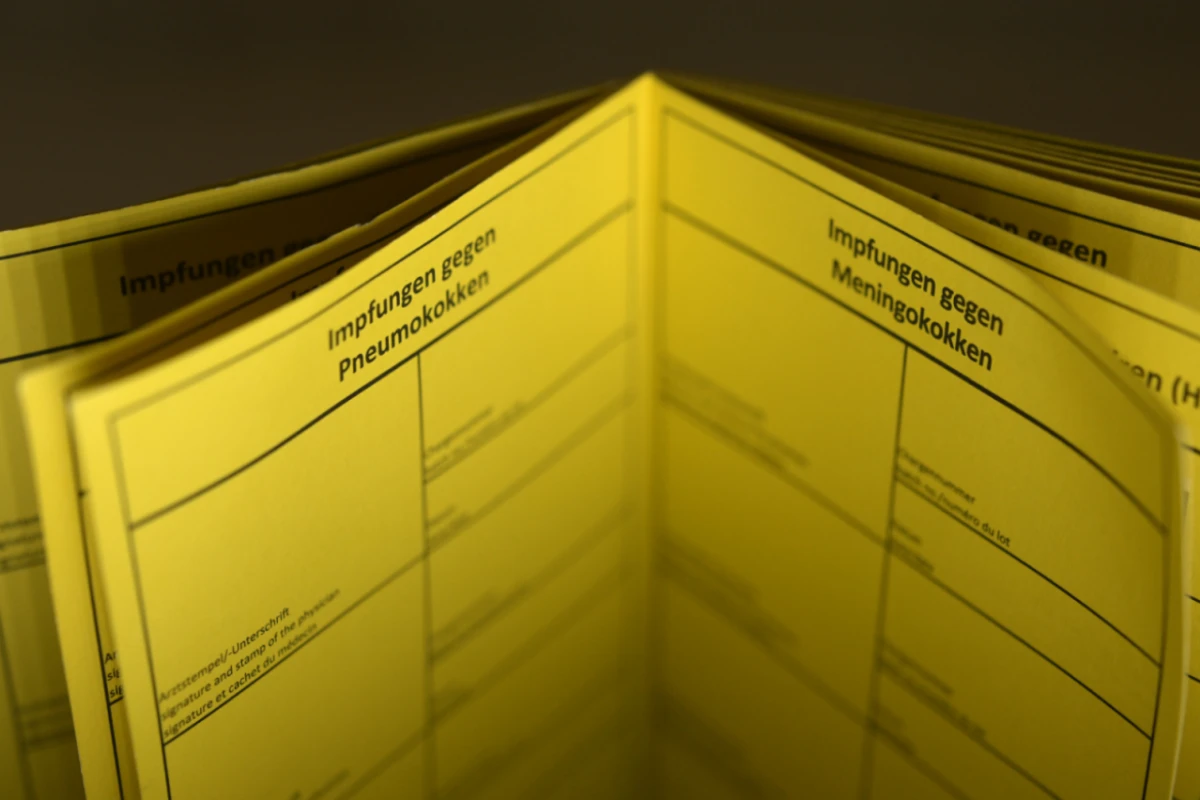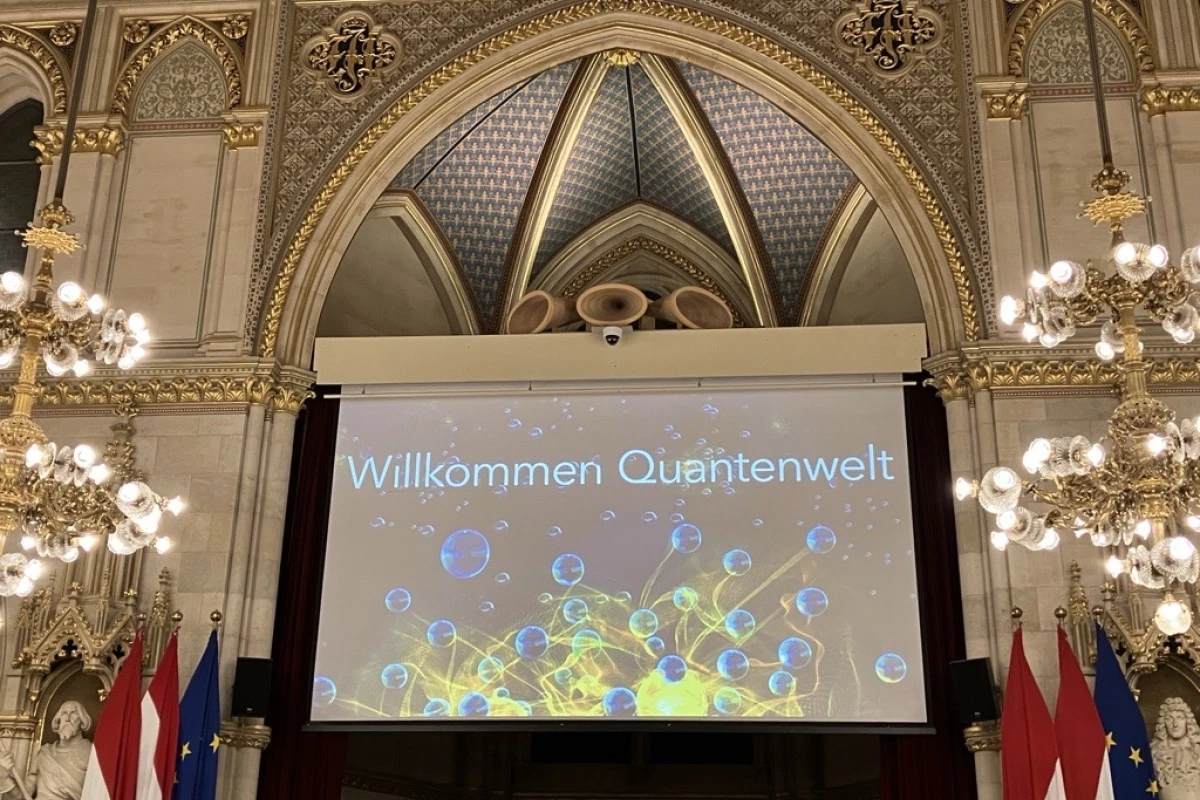von
Der Mensch hat in der Vergangenheit, vor allem aber im vergangenen Jahrhundert, Fließgewässer durch Regulierung zu Abflusskanälen "degradiert". Im Vorarlberger Rheintal geschah das zum Ende des 19. Jahrhunderts insbesondere zum Zweck des Hochwasserschutzes. Durch die Einengung und Begradigung der Gewässer wurden aber auch viele für Menschen positive Effekte von Flüssen zerstört. So gingen beim Alpenrhein zwischen Österreich und der Schweiz mit dem Verschwinden des geschwungenen Flussverlaufs auch ökologisch wichtige Lebensräume wie Totholzstrukturen und flache Uferbereiche verloren. Für Fische ist der Rhein in seiner aktuellen Gestaltung kein Lebensraum mehr. Außerdem fehlt den regulierten Flüssen bei größeren Wassermengen der Platz, um das Wasser zurückzuhalten. Im Falle des Rheins wurden dafür sogenannte Vorländer eingerichtet.
Erst in den vergangenen Jahrzehnten wurde die Einengung von Flüssen als Problem begriffen. Naturbasierte Flussrenaturierung hat das Ziel, durch naturnahe Lösungen wieder nachhaltige Flusslandschaften zu schaffen und dadurch gleichzeitig ökologische Integrität, soziale Bedürfnisse und wirtschaftliche Aktivitäten in Einklang zu bringen. Beispiel Hochwasserschutz: Statt Dämme zu errichten, um Flüsse nicht über die Ufer treten zu lassen, werden nun Flussbecken ausgeweitet oder Überflutungsflächen geschaffen. So können Abflussspitzen gedämpft, die Habitat-Vielfalt erhöht, die Wasserqualität verbessert und Erholungsräume geschaffen werden. Die entstehenden Feuchtgebiete und Flussauen sind außerdem ein wichtiger Speicher für CO2.
Dieses Prinzip soll beim Projekt RHESI grundsätzlich auch am Alpenrhein gelebt werden. Zwar ist eine Renaturierung nicht auf den gesamten 26 Flusskilometern möglich. Doch sollen Aufweitungen, sogenannte Kernlebensräume, weniger renaturierbare Engstellen kompensieren. An der Einmündung der Frutz in den Rhein soll der Fluss wieder bis zu 400 Meter breit werden dürfen. Verästelungen, Kiesbänke, Auwald und Stillwasserzonen sollen sich bilden. Weitere Kernlebensräume sind bei Mäder-Kriessern (Bez. Feldkirch/Kanton St. Gallen) und Lustenau-Widnau (Bez. Dornbirn/Kanton St. Gallen) vorgesehen sowie eine Aufweitungsstrecke vor der Bodenseemündung.
Spätestens in 80 Jahren soll der Rhein wieder naturnah sein. Schon davor wird er sich wieder als verflochtener Fluss durch Kiesbänke und Auwald schlängeln. Sowohl am und im Fluss wird mit einer deutlichen Erhöhung der Artenvielfalt gerechnet, ebenso mit der Entstehung von Auwäldern. Dort sollen sich verschwundene Arten wieder ansiedeln, vor allem kiesbankbrütende Vögel, Insekten und selten gewordene Pflanzenarten.
15.08.2025, Rheinland-Pfalz, Bingen: Ein Binnenschiff fährt am Mäuseturm vorbei über den Rhein. Bei anhaltender Trockenheit und ausbleibenden Niederschlägen drohen der Schifffahrt Einschränkungen. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++