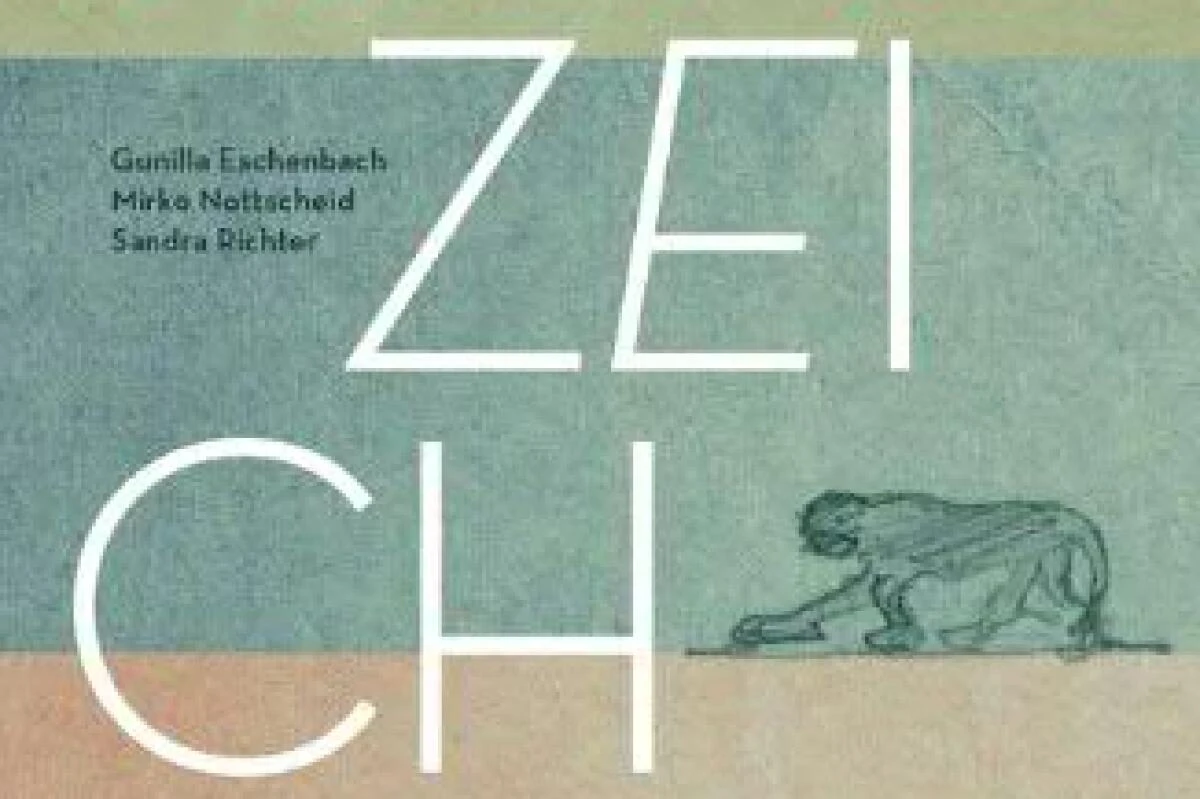von
Festgestellt wurde im am Freitag veröffentlichten Bericht zu "Medienförderungen durch die KommAustria und die RTR", dass die Medienförderungen des Bundes zwischen 2019 und 2024 um 88 Prozent - von 46 Millionen Euro auf rund 87 Millionen Euro - angestiegen sind. In diesem Zeitraum wurden eine Digitalisierungsförderung und die Qualitätsjournalismusförderung eingeführt. Kritisch angemerkt wurde, dass die Verwaltung und Vergabe der Medienförderungen mit einer Ausnahme in die Verantwortung von Einzelpersonen fallen. Beiräte sprechen lediglich Empfehlungen zur Vergabe aus.
Sämtliche Förderungen seien an eine Mindestbestehdauer der Medien geknüpft, womit neue Medienunternehmen nicht umfasst sind. Auch seien wirtschaftliche Kriterien maßgeblich für die Förderhöhe, wodurch sich eine "strukturerhaltende Wirkung" ergebe. Strukturwandel - etwa zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber großen globalen Plattformen, zur Weiterentwicklung der Finanzierungsmodelle oder zur Fähigkeit, verändertem Nutzerverhalten zu begegnen - sei dagegen derzeit nicht entscheidend, stellten die Prüfer fest und richteten an das Medienministerium die Empfehlung, die Förderprogramme weiter gegenüber neuen Marktteilnehmern zu öffnen, um so den Ausbau der Medienvielfalt zu stützen.
Kritisch merkt der Rechnungshof zudem an, dass konkrete Qualitätskriterien kaum eine Rolle bei der Vergabe der Fördermittel spielen. Die Empfehlung lautet hier, das zu ändern und zudem eine Harmonisierung der inhaltlichen Ausschlussgründe anzustreben. Aus Transparenzgründen empfiehlt der Rechnungshof zudem, einen Gesamtüberblick über die öffentlichen Mittel, die an Medienunternehmen ausgeschüttet werden - Förderungen und Inserate - zu veröffentlichen.
Erst unlängst sorgte für Aufsehen, dass das umstrittene Online-Boulevardmedium "Exxpress" in den Genuss von Mitteln aus der Qualitätsjournalismusförderung kam. Medienminister Andreas Babler (SPÖ) zeigte sich irritiert und kündigte mit Blick auf das Medienfördersystem ein Reformpaket mit einer Vielzahl an Maßnahmen an. Details dazu nannte er noch nicht.
Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) nahm den Rechnungshofbericht zum Anlass, auf die Wichtigkeit des Privatrundfunkfonds hinzuweisen und eine üppigere Dotierung zu fordern. Denn die Refinanzierung aus Werbung sei zunehmend schwieriger, weil große Online-Plattformen immer mehr Werbebudgets aus Österreich absaugen würden. Die Förderung ziele entgegen anderer Zuwendungen im Medienbereich auf Inhalte anstatt Auflagen- oder Mitarbeiterzahl ab. Für eine Diskussion über zusätzliche Qualitätskriterien sieht VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm keine Veranlassung im Rundfunkbereich. Denn die Qualität sei gesetzlich garantiert und werde durch die KommAustria überwacht. "Die wirklichen Risiken gehen von den 'Sozialen Medien' aus, die nach wie vor nahezu ungehindert falsche oder einseitige Informationen verbreiten", so Drumm.
Abseits der Medienfördervergabe ortete der Rechnungshof mit Blick auf die RTR und ihrer 155 Beschäftigten einen hohen Gender-Pay-Gap. Im Jahr 2023 betrug dieser 34 Prozent und lag damit deutlich über dem Gender-Pay-Gap des österreichischen Bundesdienstes von zuletzt 8 Prozent und jenem der Privatwirtschaft von 18 Prozent (2022). Auch wird kritisch angemerkt, dass die Räumlichkeiten der RTR wie auch die Website bei wesentlichen Inhalten nicht barrierefrei seien und Ende 2022 drei von fünf Pflichtstellen nach dem Behinderteneinstellungsgesetz unbesetzt waren.
Die Prüfer empfehlen der RTR zudem eine "fachbereichsübergreifende Unternehmensstrategie und eine daraus abgeleitete Personalstrategie" zu erarbeiten. Denn die Geschäftsstelle sei zusehends mit neuen Herausforderungen betraut - etwa einer Servicestelle für Künstliche Intelligenz oder einer Schlichtungsstelle für Video-Sharing-Plattformen. Die RTR solle ineinandergreifenden Themen fachbereichsübergreifend begegnen, hieß es.