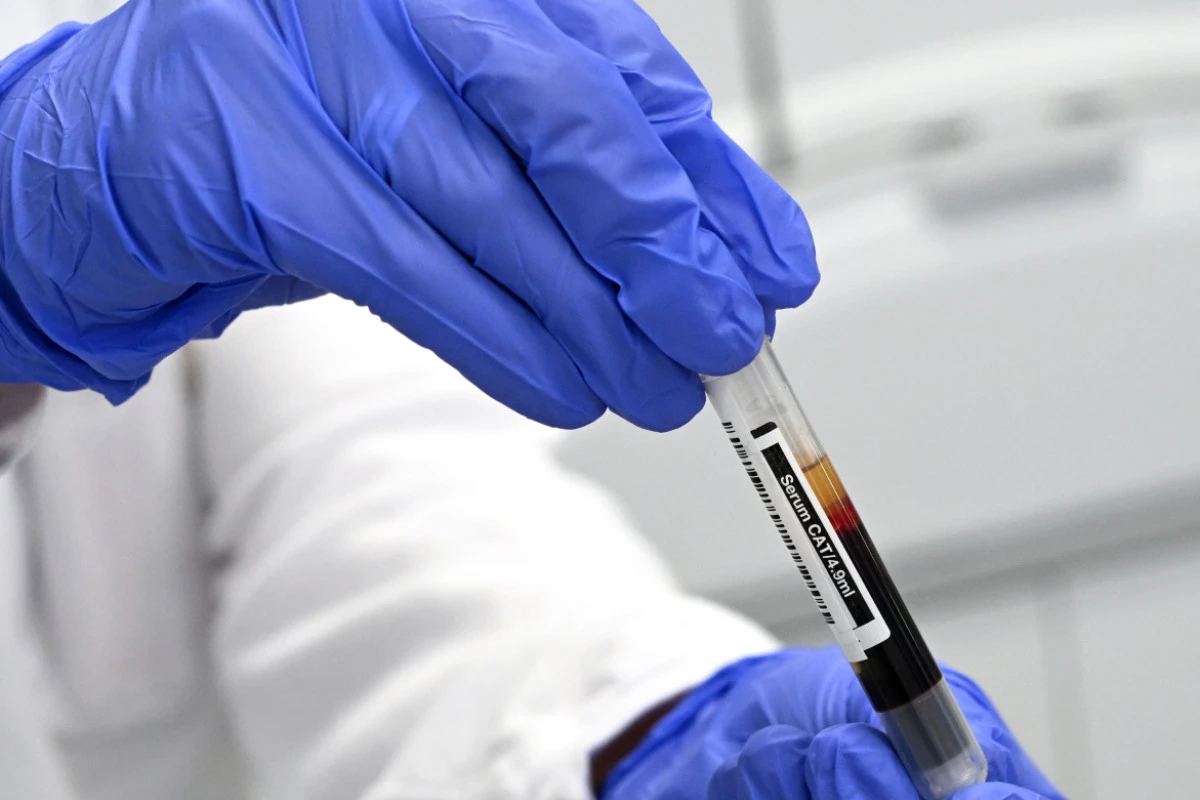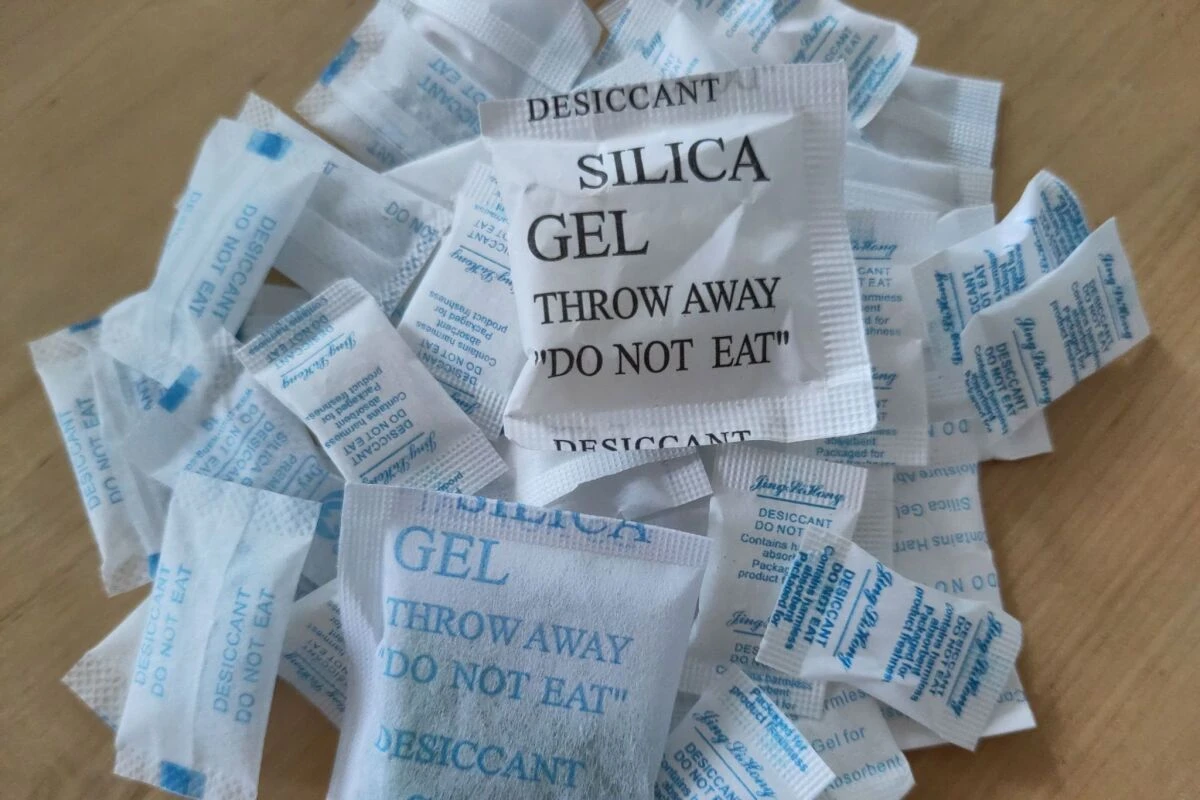von
"Zumindest 212 Medikamente mit monoklonalen Antikörpern haben bisher Dutzenden Millionen Menschen geholfen. (...) Das weltweite Marktvolumen für monoklonale Antikörper (allein als Medikamente; Anm.) betrug im Jahr 2024 rund 250 Milliarden US-Dollar (215,37 Mrd. Euro) und soll sich binnen fünf Jahren verdoppeln", schrieb die britische Wissenschaftszeitschrift "Nature" vor kurzem.
"Die Herstellung von vordefinierten spezifischen Antikörpern in Zelllinien in Laborkulturen ist von großem Interesse. (...) Wir beschreiben die Ableitung einer Reihe von Zelllinien, die Antikörper gegen rote Blutzellen von Schafen produzieren. Diese Zelllinien wurden durch die Fusion von Maus-Myelom- und Maus-Milzzellen eines immunisierten Spenders geschaffen", schrieben Köhler und Milstein in ihrer Arbeit, die als "Letter" vor einem halben Jahrhundert in "Nature" veröffentlicht worden ist (https://doi.org/10.1038/256495a0). 1984 erhielten der gebürtige Deutsche Köhler und der Argentinier Milstein dafür den Medizin-Nobelpreis, gemeinsam mit dem gebürtigen Briten Nils Jerne (dieser für Forschungen zum spezifischen Aufbau und die Steuerung des Immunsystems).
Der Weg zu der Jahrhunderterfindung war steinig. Ab den 1960er-Jahren hatten Wissenschafter langsam verstehen gelernt, woraus Antikörper als Teil des Immunsystems bestehen und vor allem wie sie entstehen: Produziert werden sie in bestimmten Immunzellen (Plasmazellen) als Reaktion auf den Kontakt des körpereigenen Abwehrsystems mit einem Antigen, zum Beispiel einem Bestandteil eines in den Organismus eingedrungenen Krankheitserregers. Antikörper können Antigene direkt neutralisieren. Sie können auch Krankheitserreger für den Angriff durch Abwehrzellen markieren oder andere Abwehrmechanismen in Gang setzen.
Im Rahmen der Forschungsaktivitäten zur Aufhellung der Details wurde der Bedarf nach spezifischen Antikörpern immer größer. Milstein und Köhler experimentierten so lange, bis sie einen gangbaren Weg gefunden hatten: Sie "immunisierten" Mäuse mit einem spezifischen Antigen und entnahmen ihnen dann B-Zellen (weiße Blutkörperchen) aus der Milz. Unter ihnen befanden sich auch bereits ausdifferenzierte Plasmazellen, welche zu dem Antigen passende Antikörper produzierten. Diese Zellen wurden dann mit Myelomzellen von Mäusen fusioniert. Es entstanden hybride Zellen: Antikörper produzierende Zellen, die gleichzeitig die Fähigkeit zur endlosen Teilung besaßen. Multiple Myelome als bösartige Bluterkrankung entstehen aus sich unkontrolliert vermehrenden Plasmazellen.
Selten hat eine Entdeckung die Medizin, in diesem Fall den gesamten Bereich der Life-Sciences, so mitbestimmt wie das industriell verwertbare Verfahren zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern praktisch nach Belieben. Die Entwicklung in der pharmazeutischen Industrie ging von Maus-Antikörpern über chimäre zu "humanisierten" und letztendlich "humanen" monoklonalen Antikörpern, was die möglichen Nebenwirkungen drastisch reduzierte bzw. die Anwendung erleichterte. Doch auch um ganz spezifisch Proteinstrukturen in Gemischen zu suchen, eignen sich natürlich monoklonale Antikörper genauso, was ihre Verwendung in Labors und in der Diagnostik so wichtig macht.
Ein aktuelles Detail: Das weltweit "wertvollste" Arzneimittel (Halbjahresumsatz 2025: 15 Milliarden US-Dollar), Pembrolizumab als bei mehreren Krebserkrankungen wirksames Immuntherapeutikum, ist ein monoklonaler Antikörper.
Trastuzumab als Medikament bei einer bestimmten Form des Mammakarzinoms hat die Krebstherapie auf diesem Gebiet revolutioniert. Monoklonale Antikörper werden zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration genauso eingesetzt wie bei der "passiven" Impfung von Säuglingen gegen RSV-Infektionen. In der Therapie von Autoimmunerkrankungen wie die rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn, atopische Dermatitis und Psoriasis werden monoklonale Antikörper ähnlich erfolgreich eingesetzt wie bei schwerem Asthma.
Die effektivsten Arzneimittel zur Senkung überhöhter Cholesterinkonzentrationen im Blut und gegen die Osteoporose sind monoklonale Antikörper, ebenso auch Medikamente, welche die Beherrschung von Krankheiten wie die Multiple Sklerose ermöglicht haben. Auch die ersten, noch beschränkt wirksamen ursächlichen Therapien gegen Morbus Alzheimer bestehen aus monoklonalen Antikörpern. Hinzu kommen sogenannte bispezifische Antikörper, welche ganz gezielt verstärkte Immunreaktionen bei Krebserkrankungen erzeugen sollen. Die kleinen Proteine mit ihren Bindungsstellen für jeweils spezifische Eiweißstrukturen an der Spitze werden auch zunehmend als zielgenaue Transportmittel (Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, ADCs) in der Onkologie verwendet, um Chemotherapeutika oder strahlende Wirkstoffe möglichst ausschließlich in Krebszellen einzuschleusen.
"Die kolossale Industrie, die rund um monoklonale Antikörper entstanden ist, wächst weiter. Wissenschafter suchen nach Antworten für neue Fragen. Zum Beispiel, wie man Künstliche Intelligenz einsetzen kann, um Antikörper mit medikamentenähnlichen Eigenschaften zu entwerfen - eine Aufgabe, die komplizierter ist, als solche Werkzeuge zur Vorhersage von Proteinstrukturen zu verwenden", hieß es jetzt dazu in "Nature". Kein Wunder, dass der weltweite Umsatz mit den kleinen Proteinen aus der Immunologie allein für therapeutische Zwecke jährlich um fast 15 Prozent wächst. 2029 soll er bereits rund 500 Milliarden US-Dollar betragen.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose