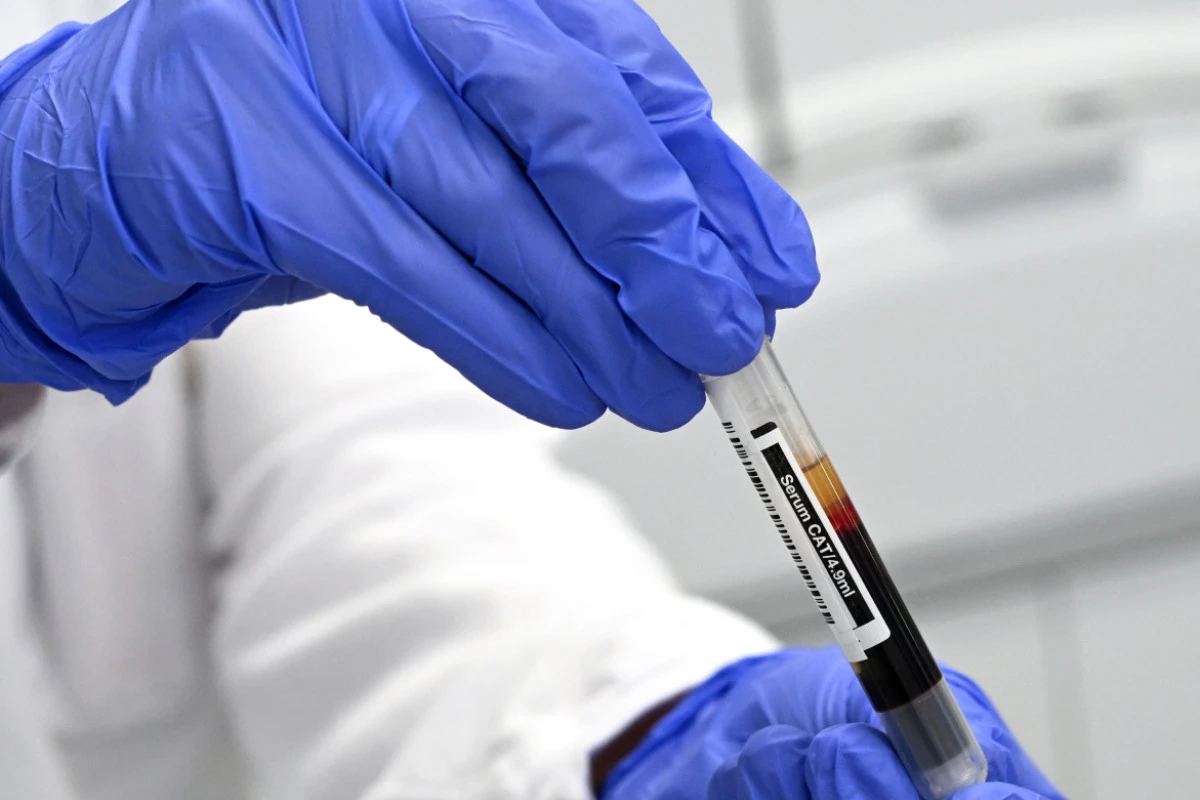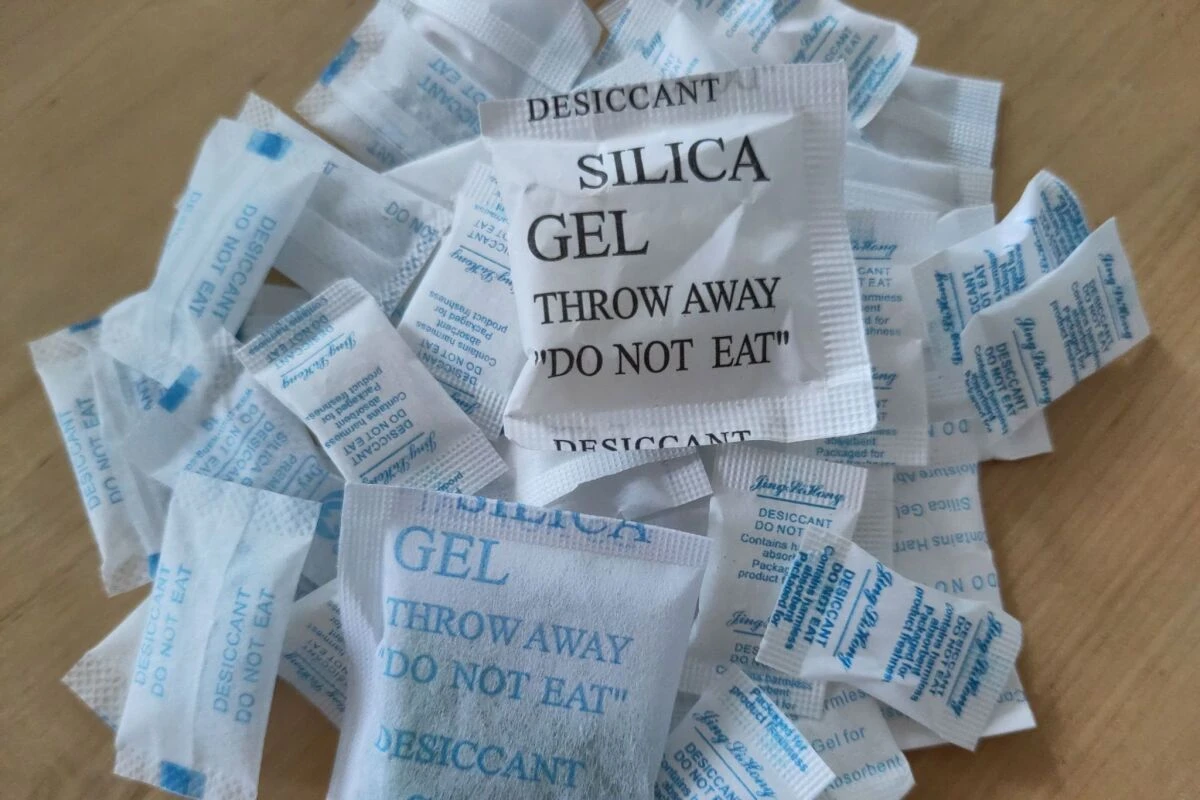von
Der erste eigenständige Einkauf ist für Kinder ein prägender Moment und stärkt ihr Selbstbewusstsein. Volksschulkinder können kleine Besorgungen, wie Weckerl beim Bäcker holen, oft schon gut bewältigen. "Mit sieben bis acht Jahren verstehen sie den Umgang mit Geld besser", sagt die Sozialpädagogin, Dana Mundt.
Eltern sollten das Einkaufen vorab spielerisch üben – zunächst zu Hause, dann in Begleitung. Wichtig ist, dass sie Vertrauen zeigen und kleine Erfolge gezielt loben: "Du hast dich getraut, das finde ich toll! Beim nächsten Mal kannst du noch aufs Wechselgeld achten", rät Mundt. Im Hintergrund bleiben sie unterstützend erreichbar, falls etwas schiefgeht.
Auch im Haushalt können Volksschulkinder mehr Aufgaben übernehmen. "Je früher man beginnt, desto einfacher wird es", sagt Mundt. Schon im Kindergarten-Alter können Kinder den Tisch decken, Spielsachen wegräumen oder ihre Sporttasche packen – erst mit Anleitung, später selbstständig.
Wichtig ist, die Erwartungen anzupassen: Ein perfektes Ergebnis muss nicht das Ziel sein. Stattdessen sollten Eltern freundlich und ermutigend bleiben, so die Sozialpädagogin. Etwa mit Fragen wie: "Was fiel dir leicht? Was war schwieriger?" So bleibt man im Dialog und erkennt, wie das Kind mit den Aufgaben zurechtkommt und wo es noch Hilfen braucht.
Die Betreuung jüngerer Geschwister ist eine echte Möglichkeit, Verantwortungsbewusstsein zu stärken. "Ein Schulkind kann man darum bitten, mit jüngeren Geschwistern zu spielen", sagt Mundt. Die Aufgabe sollte jedoch klar definiert und an das Alter sowie die Fähigkeiten des Kindes angepasst sein.
Ein achtjähriges Kind kann für kurze Zeit auf ein jüngeres Geschwisterkind aufpassen, sollte dabei aber nicht überfordert werden. Möglich ist abzusprechen: "Wenn ihr euch streitet, bist du der Ältere und hast mehr Verantwortung", sagt Stefanie López, die als Familientherapeutin arbeitet. Eltern sollten in der Nähe bleiben, um bei Problemen eingreifen zu können.
Im Kindergarten organisierten Eltern noch die Spieltreffen. In der Volksschule beginnen Kinder, sich selbst zu verabreden – und müssen lernen, ihre Pläne mit den Eltern abzusprechen. Ausprobieren kann man das in einem "geschützten, sicheren Rahmen", so Mundt. Sie schlägt vor, das Kind mit einem Nachbarskind spielen zu lassen und ihm zu sagen, es solle ab und zu auf die Uhr schauen, um zur verabredeten Zeit nach Hause zu kommen. Denn die Uhrzeit erlernen Kinder im Volksschulalter.
Spielt das Kind später bei Schulfreunden, sollten die Eltern im Notfall erreichbar sein – Telefonnummern auszutauschen und klare Absprachen schaffen auch hier Vertrauen.
Auch der Schulalltag bietet viele Gelegenheiten, Selbstständigkeit zu fördern. Eltern können auf dem Schulweg mögliche Gefahrenstellen mit dem Kind abgehen und Verkehrsregeln spielerisch abfragen. Etwa mit Fragen wie: "Was machst du, wenn ...?" Solche Übungen geben Sicherheit, sich alleine auf dem Schulweg zu bewegen, so López.
Auch das eigenständige Packen der Schultasche oder das Erledigen der Hausaufgaben sind gute Übungen. "Für den Anfang reicht es schon, Verantwortung in kleinen Dosen zu übernehmen", so Mundt.
Ein häufiger Stolperstein ist der Zeitdruck am Morgen. Hier rät López, sich als Eltern zu reflektieren: "Wenn ich pünktlich sein will, spürt das Kind den Druck, übernimmt ihn aber nicht unbedingt." Besser sei es, Fehler zuzulassen – in der Schule erhalte das Kind ohnehin Rückmeldung. Das helfe viel mehr.
Der Weg zu mehr Selbstständigkeit ist ein Prozess, der Zeit braucht. "Manche Kinder stehen sofort auf, wenn der Wecker klingelt. Andere werden noch mit zehn Jahren geweckt", erzählt López. Eltern sollten anerkennen, dass jedes Kind unterschiedlich ist, und Aufgaben an individuelle Fähigkeiten anpassen. Fragen wie "Was brauchst du, damit es klappt?" helfen, Hindernisse gemeinsam zu überwinden.
Loslassen gehört auch dazu: "Für das Kind ist es wichtig, sich im Leben bewegen zu können. Man lernt nichts, ohne Fehler zu machen und zu scheitern", sagt López. Eltern sollten daher Schritt für Schritt Verantwortung abgeben und sich selbst reflektieren: "Wo bin ich überfordert, und wie kann ich den Übergang gestalten?" Am Ende profitieren alle davon – Kinder entwickeln Selbstvertrauen und Eltern gewinnen ihre eigene Zeit zurück.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Mascha Brichta/Mascha Brichta
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Kirsten Neumann/Kirsten Neumann
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Mascha Brichta/Mascha Brichta