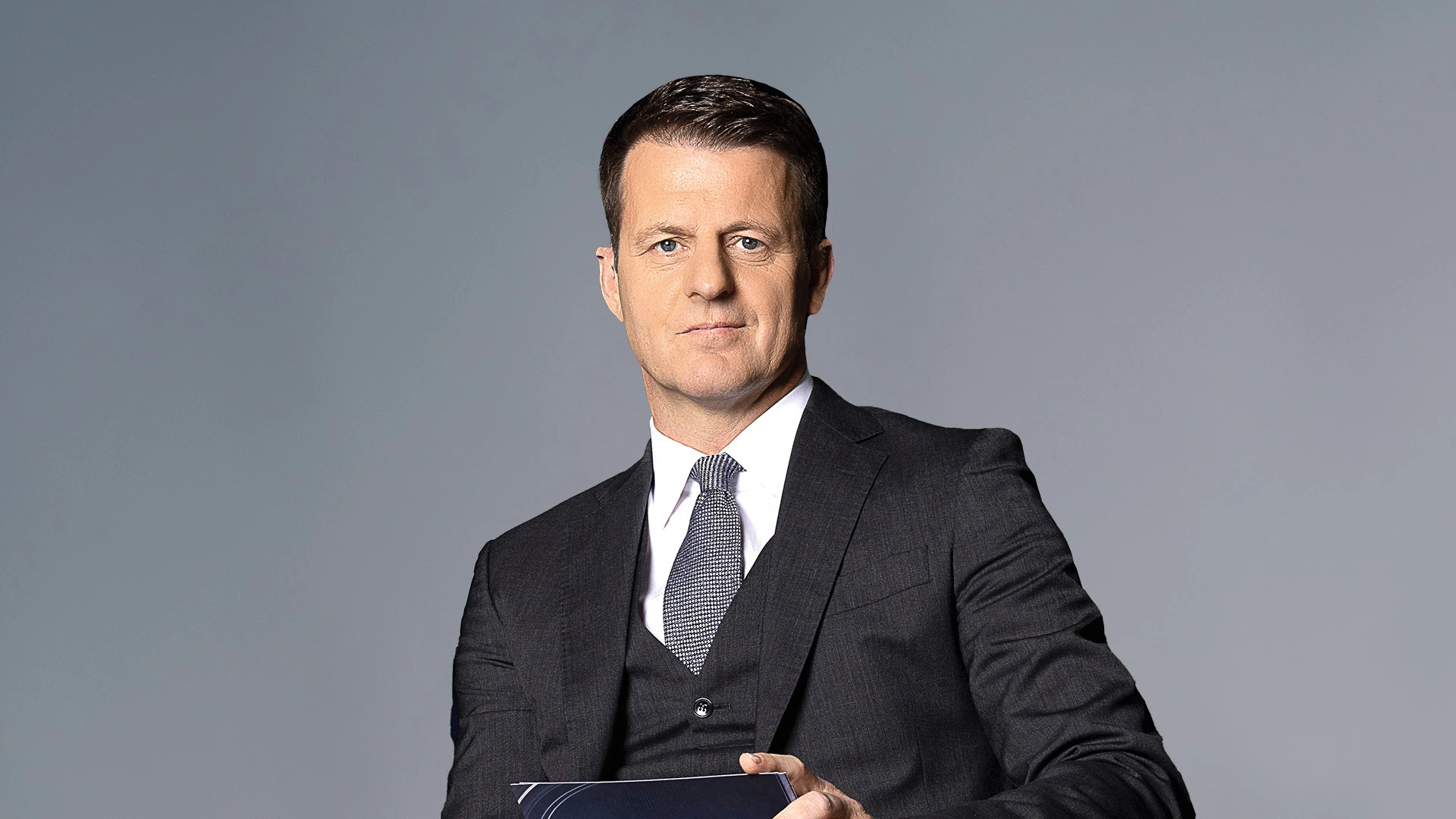Donald Trumps wissenschaftsfeindliche Politik führt zu Protesten und Abwanderungen von Wissenschaftern.
©Sipa USA / Alamy Stock PhotoDonald Trump vertreibt die Wissenschaft – das könnte für Europa eine Chance sein. Doch dazu müssen auch die Rahmenbedingungen passen, warnen Experten.
Donald Trump wütet an allen Ecken und Enden – besonders dramatisch sind die Auswirkungen seiner Brachialpolitik für Wissenschaft und Forschung. Seine Beratertruppe, die sich aus Milliardären, religiösen Fanatikern und rechtslastigen Influencern zusammensetzt, hat schon aus Prinzip etwas gegen Wissen, Aufklärung und Meinungsfreiheit. Die Eliteuniversität Harvard bezeichnete Trump jüngst in einem Post als „Bedrohung für die Demokratie“. Harvard sei eine antisemitische, linksradikale Institution, die Studenten aus aller Welt annehme, „die unser Land auseinanderreißen wollen“, so Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Die Folge: es wird im großen Stil bei Universitäten, Forschungseinrichtungen und Hilfsorganisationen gespart und gestrichen, was der Rotstift hergibt. So brechen Programme zur Gesundheitsvorsorge in vielen Ländern zusammen, weil die Weltgesundheitsorganisation WHO Stellen streichen muss; rund 2.500 WHO-Experten weltweit suchen nach neuen Jobs. In den USA selbst geraten Institutionen wie die New Yorker Columbia University unter Druck – wer nicht spurt und beispielsweise seine Diversity-Vorgaben ändert, verliert kurzerhand öffentliche Mittel. Unter Vorwänden wie angeblichem Antisemitismus, weil anti-israelische Proteste an Unis nicht rasch verhindert wurden, oder ideologischer Verblendung, weil auf Gleichberechtigung geachtet wird, werden öffentliche Mittel in Wissenschaftsbereichen wie Klimawandel oder Medizin gestrichen.
Der Exodus der US-Wissenschafter hat begonnen: So verlassen gleich drei renommierte Forschende der Yale-Universität das Land: Historiker Timothy Snyder und seine Frau Marci Shore, eine Osteuropahistorikerin, wollen sich ebenso in Kanada ansiedeln wie Faschismusforscher Jason Stanley. Universitäten und Forschungseinrichtungen in Europa berichten bereits von steigenden Anfragen aus den USA nach freien Stellen.
Trumps Feldzug gegen die Wissenschaft könnte sich demnach als Chance für Europa erweisen. Für Deutschland planen CDU/CSU und SPD Medienberichten zufolge ein Anwerbeprogramm für Spitzenforscher aus den USA: Unter dem Schlagwort „1.000 Köpfe“ sollen internationale Talente unter anderem für die Forschung zur Quantentechnologie ins Land geholt werden.
Talentverlust umkehren
Welche Chancen bieten sich nun für Österreich? Es häufen sich auch hier die Anfragen, ob es offene Stelle gäbe, erzählt Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und ehemaliger Bildungs- und Wissenschaftsminister. „Wir können den langjährigen Verlust von Talenten in Richtung USA erstmals und ernsthaft umdrehen.“
Laut Christof Gattringer, Präsident des Wissenschaftsfonds FWF, stellt sich in der Grundlagenforschung die Frage der Attraktivität des Standorts losgelöst von der Situation in den USA. Es gehe um eine „offene und international orientierte Wissenschaftskultur“ in Österreich, die es für die besten Köpfe der Welt attraktiv macht, hierzulande zu forschen. Würden dann auch die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen – etwa, um ausreichend Drittmittel einwerben zu können –, spreche vieles für einen Wechsel an eine österreichische Universität oder Forschungsstätte. Gattringer warnt aber: „Der Wachstumskurs in Wissenschaft und Forschung sollte trotz angespannter Budgetlage fortgeführt werden, um hier die richtigen Signale auch in Richtung USA zu setzen.“


Christof Gattringer
Jetzt wäre es an der Zeit, aktiv junge Talente und erprobte Spitzenforscher aus den USA zu rekrutieren, meint auch Gerd Gigerenzer, Vizepräsident des Europäischen Forschungsrats und Direktor emeritus am Max-Planck-Institut. „Dazu muss man aber zuerst die langwierigen und umständlichen Einstellungsverfahren abschaffen, und durch schnelle und attraktive Angebote an ausgesuchte US-Forscherinnen und Forscher ersetzen.“
Gigerenzer weist darauf hin, dass der Europäische Forschungsrat ERC gerade beschlossen hat, jenen Wissenschaftern, die aus dem Ausland in ein EU-Land umziehen und ein ERC-Grant gewinnen, als Anreiz extra eine Million Euro zu bezahlen. „Das Problem ist aber nicht allein das Geld, sondern die unmündig machende Bürokratie mancher europäischer Universitäten, die gute US-Forscher abschreckt.“ Es gelte also Anreize für die Verwaltung zu setzen, sodass sie schnell entscheidet. Bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben lagen die USA mit jährlich rund 710 Milliarden Dollar bisher deutlich vor der EU (400 Milliarden Dollar). Zudem verfügte das Land auch über die beste Infrastruktur, weniger Regulatorien und ausgezeichnete Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen und Start-ups.
Wien, Linz oder Zürich?
Kann Europa da mithalten? „Wenn Österreich international führende Forschung ins Land holen will, braucht es konkurrenzfähige Institutionen“, sagt Gerald Schweiger, Professor an der TU Wien. Eine Spitzenuniversität wie die ETH Zürich entstehe nicht durch Gleichverteilung der Mittel auf alle Universitäten. Wien bringt seiner Meinung nach als zentraleuropäische Metropole alle Voraussetzungen für den Standort einer solchen Spitzenuniversität mit. „Was Österreich hingegen sicher nicht braucht, ist eine neue Digital-Uni in Linz – insbesondere nicht in einem bereits stark fragmentierten Hochschulsystem mit vielen kleinen UniversitätenUniversitäten.“ Tatsächlich verfügt Österreich über fast doppelt so viele öffentliche Universitäten wie die Schweiz.
Eine Hürde könnte das System der Forschungsförderung sein, um attraktive Rahmenbedingungen zu bieten. Zwar sei es unwahrscheinlich, dass es das eine optimale Fördersystem überhaupt geben kann, sagt Schweiger. „Was sich aber immer deutlicher zeigt: Das derzeitige System ist weit entfernt von einem möglichen Optimum.“ Er hat gemeinsam mit dem Stanford-Statistiker John Ioannidis vor Kurzem im Fachjournal „PNAS“ die Auswirkungen von Wettbewerb bei der Vergabe von Forschungsmitteln unter anderem aus ökonomischer Sicht analysiert. Das Ergebnis: Bei den großen Förderprogrammen fließt bis zur Hälfte der Mittel gar nicht in die eigentliche Forschung, sondern in das Schreiben von Anträgen; Peer Reviews (also die Begutachtung durch Fachkollegen) etc. kosten nochmals Zeit. Darüber hinaus spielt der Zufall im Auswahlprozess eine erhebliche Rolle. Das bedeutet: „Ein großer Teil der Forschungsgelder fließt nicht in die Forschung selbst, sondern in die Gestaltung und Organisation des Wettbewerbs“, konstatiert Schweiger.
Heinz Faßmann sieht die Kritik an der bestehenden Forschungsförderung als berechtigt. Künstliche Intelligenz verändere die Glaubwürdigkeit der Anträge, aber auch der Gutachten. „Der Aufwand, erstklassige Peers zu gewinnen, steigt und die Tendenz, nur widerspruchsfreie Anträge zu fördern, verfestigt sich.“ Daher dominiere der Mainstream und wirklich disruptive Forschung mit Ecken und Kanten habe wenig Chancen. „Auf europäischer Ebene war ich Teil einer Gruppe, die über die Zukunft des Forschungsrahmenprogramms nachgedacht hat und eine der Empfehlungen lautete: experimentelle Wege gehen, um die Förderung des Neuen, des Innovativen und der großen Fragen zu gewährleisten“, sagt Faßmann.
Lernen vom Spitzensport
Schweiger stellt die Frage, ob die Wissenschaft möglicherweise etwas vom Spitzensport lernen könnte. Denn dort werde alles darauf ausgerichtet, Ablenkungen zu minimieren. „Das Umfeld wird so gestaltet, dass sich Athletinnen und Athleten voll und ganz auf den Sport konzentrieren können.“ Top-Forscher hingegen müssten Forschungsanträge schreiben, Projekte managen, administrative Aufgaben übernehmen, lehren – für die eigentliche Forschung bleibe da oft wenig Zeit. „Wir sollten die bürokratischen Belastungen und Opportunitätskosten in der Wissenschaft minimieren, damit ein Umfeld entsteht, das dem des Spitzensports ähnelt.“ Wissenschafter hätten dann die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: Wissenschaft.
Anträge statt Antworten
Kritik übt Schweiger im Speziellen an der angewandten Forschung – dort habe sich ein Ökosystem etabliert, in dem vor allem Forschungsversprechen bewertet werden, während tatsächliche wissenschaftliche Entwicklungen und Erkenntnisse für den Erfolg bei der Einwerbung künftiger Fördermittel kaum eine Rolle spielen würden. „Für viele – vor allem außeruniversitäre Akteure – ist das ein attraktives Geschäftsmodell geworden.“ In den letzten Jahren habe sich eine bemerkenswerte Expertise im Schreiben überzeugender Forschungsanträge entwickelt. Schweiger verweist auf den Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger, der einmal pointiert bemerkte, dass einiges, was unter angewandte Forschung geführt werde, vielleicht nicht ganz Forschung sei.


Anton Zeilinger
© APA, ROLAND SCHLAGERWelche Alternativen gibt es aber zum Wettbewerb um Fördergeld? Der FWF beispielsweise setzt in der finalen Entscheidungsrunde nach dem Peer-Review ein Lotterieverfahren ein. Dieses zielt darauf ab, Verzerrungen im Entscheidungsprozess zu verringern und die Chancengleichheit unter jenen zu verbessern, die es bis in diese Runde geschafft haben. Bei einer anderen Art einer solchen Lotterie wird bestimmt, wer überhaupt einen Antrag stellen darf, der später im Peer-Review begutachtet wird. Eine radikale Idee wurde in Australien ausprobiert: Dort wurden Wissenschafter darum gebeten, bis zu zehn Kollegen zu nennen, die ihrer Meinung nach eine Förderung verdienen. Ein weiterer Vorschlag für die Forschungsförderung ist ein System der Basisfinanzierung, bei dem man zwar eine bestimmte Fördersumme erhält, jedoch verpflichtet wird, die Hälfte davon an andere weiterzugeben, die für förderungswürdig gehalten werden.
Bleibt die Frage, ob es Sparten gibt, in denen sich Österreich besonders große Hoffnungen machen darf, internationale Forscher:innen zu rekrutieren? Österreich sei ein erstklassiges Forschungsland und könne in vielen Bereichen, insbesondere in den Life Sciences oder in der Quantenphysik ein attraktives Umfeld bieten, meint Faßmann. Auch FWF-Präsident Gattringer sieht hierzulande Bereiche von Weltformat; das zeige sich auch in den von FWF, Universitäten und Forschungsstätten finanzierten Exzellenzclustern.
„Wir reden von großen, über mehrere Jahre hinweg angelegten Forschungskooperationen etwa in der Quantenforschung, Mikrobiologie, Materialwissenschaften, Altersforschung oder in den Geisteswissenschaften.“ In diesen Clustern kommen Hunderte Forschende zu wichtigen Schlüsselthemen zusammen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das macht Hoffnung: „Forschende, speziell im Nachwuchsbereich, gehen dorthin, wo sie ein exzellentes Umfeld finden – da kann Österreich einiges bieten.“
Christlich-konservative Blaupause
Weniger Ausgaben für internationale Hilfs- und Forschungsorganisationen, Streichung der Zuschüsse für bestimmte Universitäten, Eliminierung des Bildungsministeriums – vieles von dem, was sich die konservative Denkfabrik Heritage Foundation in ihrem „Project 2025“ von einer Regierung gewünscht hat, ist bereits eingetreten.
Zwar hat sich Donald Trump wiederholt von den darin formulierten Plänen für ein ultrakonservatives, christliches USA distanziert. Dennoch erscheinen die Forderungen von Kevin Roberts, Präsident der reaktionären Heritage Foundation und erklärter Anhänger autoritärer Politiker wie Viktor Orbán, wie die Vorlage für das derzeitige Wüten im Wissenschaftsbereich.
Auch das „Project Esther“ der Heritage Foundation passt dazu: Eine Forderung darin lautete, pro-palästinensische Aktivisten zu deportieren. US-Medien sehen den angeblichen Kampf gegen Antisemitismus indes nur als Vorwand, politische Opposition zu unterdrücken und die Meinungsfreiheit in den USA zu untergraben. Tatsächlich beteiligen sich kaum jüdische Personen oder Organisation an dem dubiosen Projekt; hingegen wurde intern laut US-Medien beispielsweise George Soros als „Mastermind“ hinter einem Angriff auf „westliche“ Werte bezeichnet.