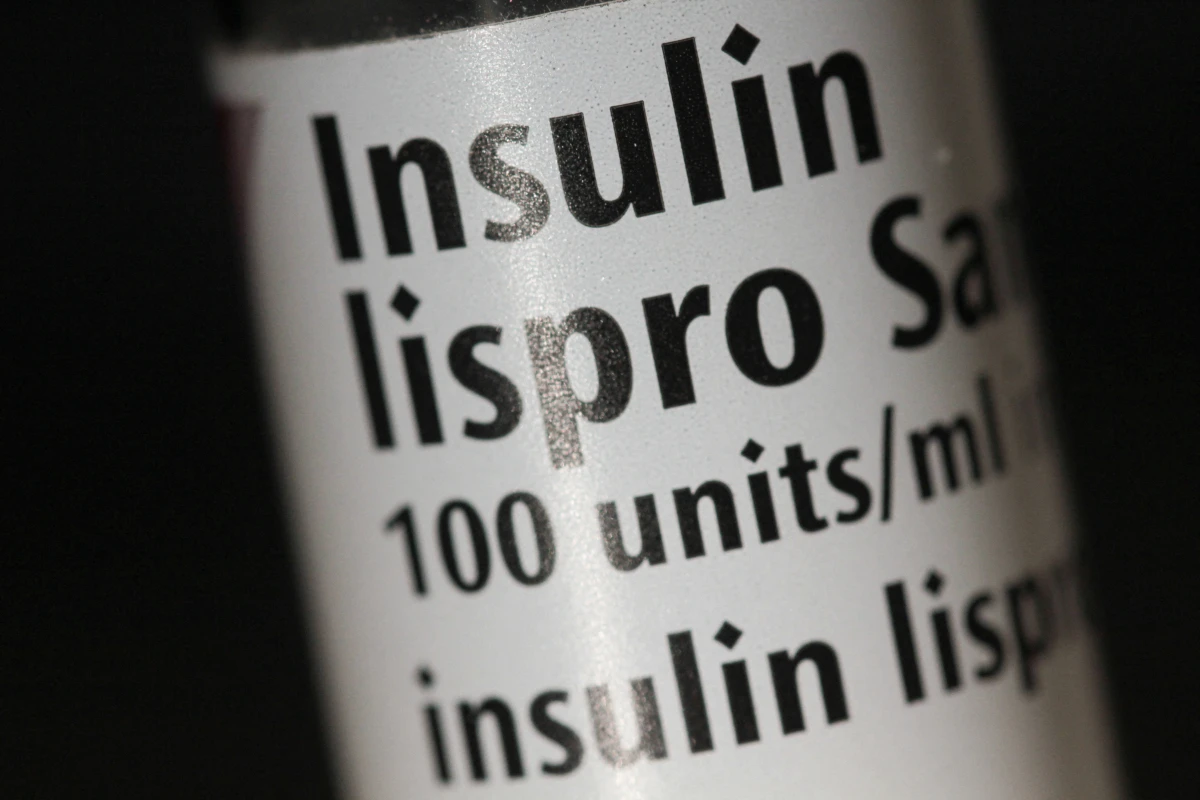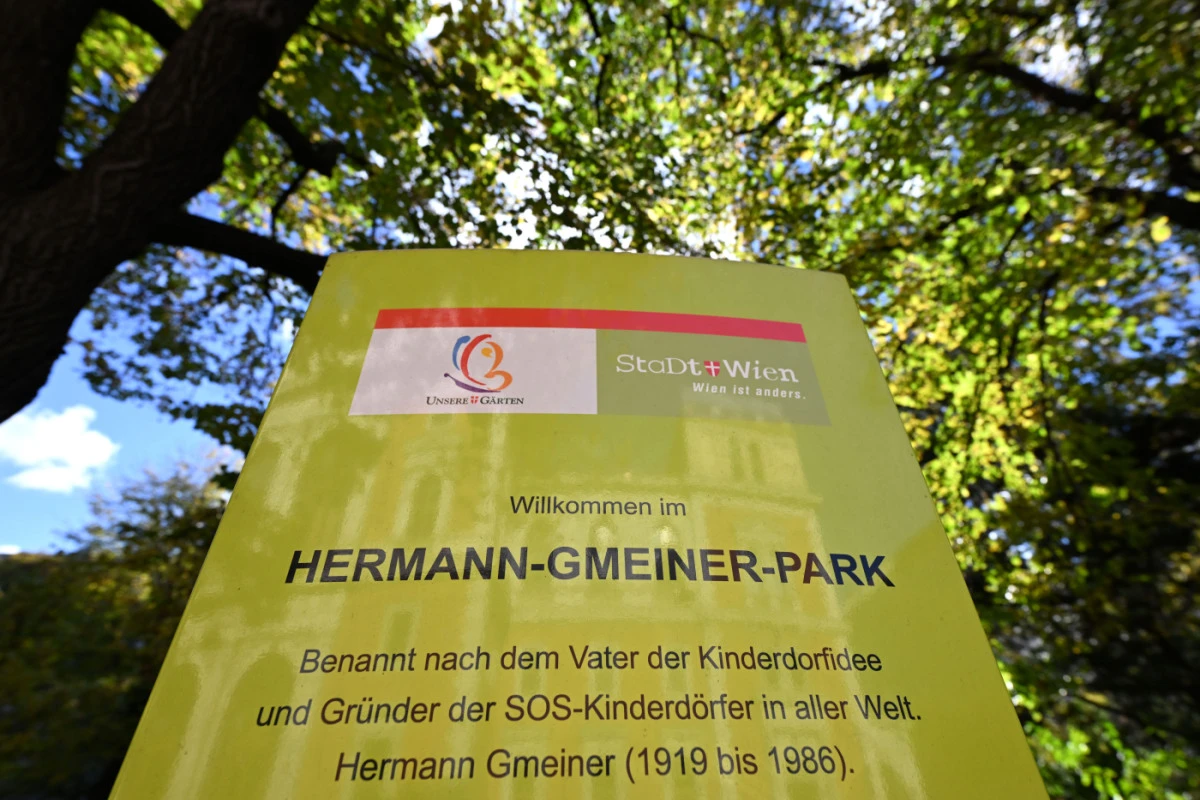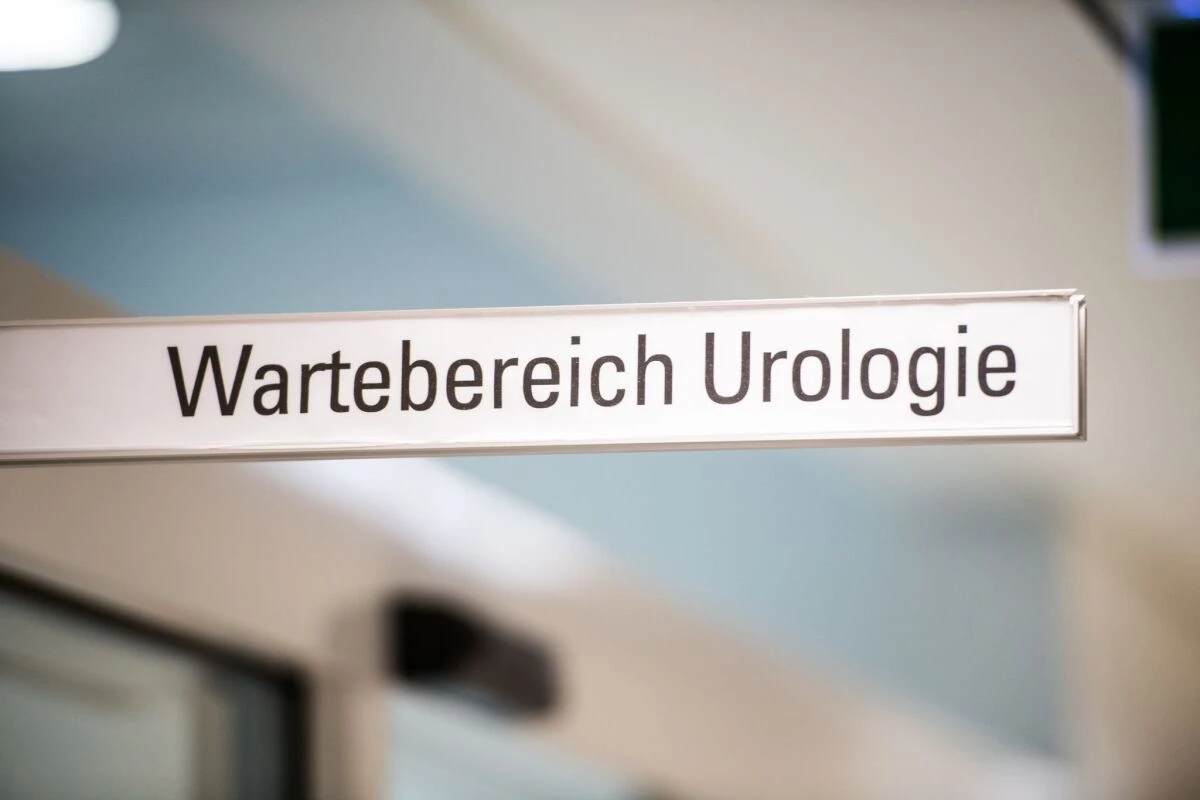von
"Obwohl wir gerade dieses Ziel verfehlen, so war es doch ein entscheidender Orientierungspunkt für viele klimapolitische Entwicklungen der vergangenen zehn Jahre", fasste etwa die Politikwissenschafterin Alina Brad von der Universität Wien den Stellenwert des Pariser Vertrags in einem Gastbeitrag für APA-Science zusammen. Sein Zustandekommen ging eine diplomatische Meisterleistung des Gastgebers Frankreich unter der Ägide des damaligen Außenministers Laurent Fabius voraus. "Die französische Diplomatie hat Großartiges geleistet und die Konferenz schon eineinhalb, zwei Jahre auf allen Ebenen vorbereitet", erinnerte sich etwa Helmut Hojesky, der langjährige österreichische Chefverhandler, in einem APA-Interview an den "absoluten Höhepunkt seiner drei Jahrzehnte umfassenden internationalen Verhandlungstätigkeit.
"Ich sehe den Saal, die Reaktion ist positiv, ich höre keine Einwände", waren die Worte von Fabius, als er die Einigung auf der UNO-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris per Hammerschlag besiegelte. Alle 195 beteiligten Staaten sagten einstimmig Ja zum Abkommen. Damit war die Aufgabe erfüllt und ein Folgeabkommen zum Kyotoprotokoll war Realität geworden, was nach dem desaströsen Scheitern der COP15 2009 in Kopenhagen wohl nicht jeder für möglich gehalten hätte. In einem Interview im Jahr 2020 betonte Fabius die Rolle der Wissenschaft für das Zustandekommen. Erst sie hätte es ermöglicht, "dass eine Mehrheit erkannt hat, dass der Klimawandel zum einen eine Bedrohung ist, und zum anderen, dass diese Bedrohung menschgemacht ist."
Bei allem Jubel, mit dem die COP21 vor zehn Jahren beendet wurde, gab es auch schon damals Kritik an dem Vertrag. Der deutsche Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber wies etwa darauf hin, dass Klimaziele im Vertrag nicht hinreichend mit Maßnahmen unterlegt würden. Konkrete Emissionswerte enthalten nur die nationalen Pläne (NDCs), deren Umsetzung aber auf eine Erwärmung um 2,7 Grad oder mehr hinauslaufen würde. 2025 war es UNO-Generalsekretär António Guterres selbst, der ein Verfehlen des 1,5-Grad-Klimaziels in den kommenden Jahren als "unvermeidlich" bezeichnet hatte. Mit den zuletzt eingereichten NDCs würde eine Erwärmung von 2,6 bis 3,1 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu erwarten sein, ging aus dem "Emissions Gap Report 2024" vom vergangenen Oktober hervor.
Attac Österreich fasste vor zehn Jahren in einer Aussendung einige der Schwächen des Pariser Klimavertrags wie folgt zusammen: "Was als Erfolg verkauft wird, beinhaltet keinerlei verpflichtende oder gar einklagbare Sanktionen zur Emissionsreduktion, keine konkreten Maßnahmen und keinen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen." Letztgenannter Ausstieg aus den Fossilen wird auch auf der COP30 wieder auf der Agenda stehen, nachdem es bis zur COP28 in Dubai gedauert hat, bis eine Abkehr von Energiequellen Kohle, Öl und Gas in einem Schlussdokument überhaupt erst einmal eine Erwähnung gefunden hat.
Trotzdem hat das Pariser Klimaabkommen seine unbestreitbaren positiven Aspekte. Politikwissenschafterin Brad nannte in ihrem Gastbeitrag hier etwa die "grundsätzliche Anerkennung von Schäden und Verlusten (loss and damage) durch die Klimakrise in der internationalen Klimadiplomatie und die Einrichtung eines Ausgleichsfonds" als wichtigen Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit - obgleich die Finanzierungszusagen in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Schäden stünden.
ARCHIV - 15.09.2023, Hessen, Frankfurt/Main: Einen Globus mit einem Miniatur-Eiffelturm und dem 1,5-Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens wird bei einer Klimaschutz-Demonstration gezeigt. (zu dpa: «Klimaschutzziele wanken – Widerstand gegen spätere Fristen») Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++