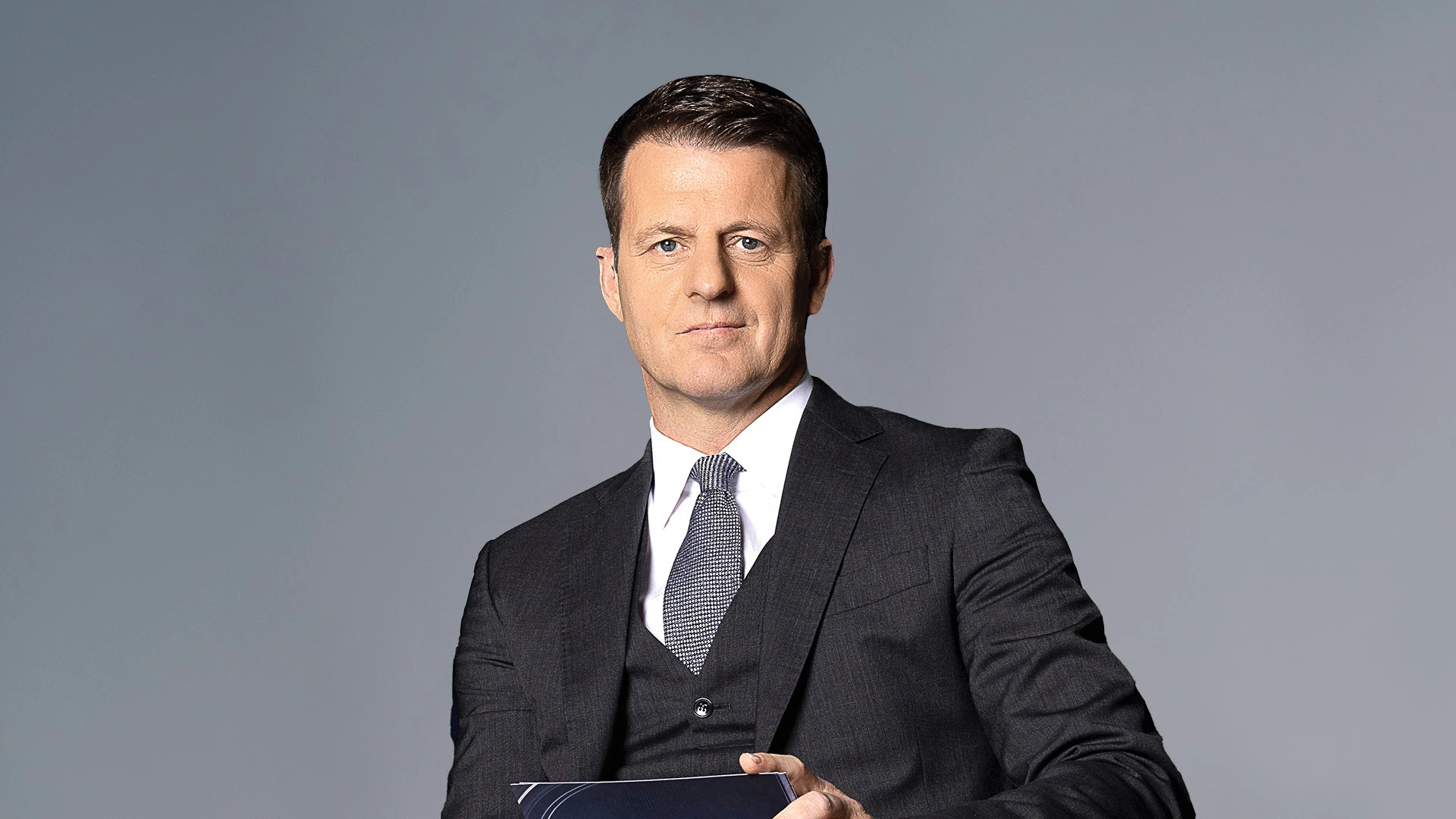Man hat es kommen sehen. Man wollte es oft nicht glauben. Jetzt ist es offiziell: Die AfD ist rechtsextrem – als Ganzes. Belegt und dokumentiert. Und trotzdem drehen sich viele weiter weg. Dabei ist jetzt vielleicht die letzte Chance, genau hinzusehen.
Am Ende durfte niemand überrascht sein. Die AfD ist nun offiziell, was sie in Teilen längst war: eine rechtsextreme Partei. Nicht mehr „teils“, sondern als Ganzes. Gesichert. Belegt in einem Gutachten, das (noch) unter Verschluss ist. Die Begründung: das „ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis“, das in der Partei vorherrscht. Dieses widerspricht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so der deutsche Verfassungsschutz, der Hass, Hetze und Demokratieverachtung auf 1.100 Seiten dokumentiert hat – offen zur Schau getragen auf Parteitagen, in Bierzelten, Talkshows und auf den Profilen der Funktionäre.
Die AfD lebt – wie die FPÖ – von dieser Stigmatisierung und vom konsequenten Verschieben von Grenzen. Der rechtsextreme Begriff „Remigration“ ist längst Konsens. „Wenn es Remigration heißen soll, dann heißt es eben Re-mi-gra-tion!“, rief Alice Weidel auf dem Parteitag – Silbe für Silbe betont. Der AfD-Abgeordnete Matthias Helferich nennt sich „das freundliche Gesicht des NS“ und postet Sätze wie „Raus mit die Viecher“. Die Partei duldet, schützt, befördert das. Und sie ist erfolgreich damit: in Sachsen zweitstärkste Kraft, in Thüringen stärkste Partei, im Bundestag größte Oppositionsfraktion. 10,3 Millionen Wählerinnen und Wähler gaben der AfD im Februar ihre Stimme. In aktuellen Umfragen liegt sie knapp vor der CDU. Eine Partei, die die Demokratie ablehnt, stellt fast ein Viertel der Bundestagsabgeordneten. Ihr Ziel: die Regierungsübernahme 2029.
Ein Parteiverbot ist heikel, aber vorgesehen. Wenn alle Warnlichter blinken. Und das tun sie längst
Totengräber im System
Das alles muss man erst einmal sacken lassen. Und nicht vorschnell zur nächsten Debatte springen: Parteienverbot. Die Hürden dafür liegen hoch – zu Recht. Auch weil die Versuchung groß ist, politischen Wettbewerb mit juristischen Mitteln einzuschränken. Ein Verfahren würde Jahre dauern, ist politisch heikel – aber: Es ist vorgesehen. Wenn alle Warnlichter blinken – und das tun sie schon lange. Es gibt keinen Automatismus zwischen Gutachten und Verbot. Aber ebenso wenig Grund, diese Diskussion als Panikmache abzuwürgen. Denn wer die Demokratie von innen zersetzen will, muss sie nicht abschaffen. Es reicht, sie lächerlich zu machen. Institutionen diffamieren, Gegner zu Feinden erklären, Misstrauen säen, Medien untergraben – und selbst definieren, was „glaubwürdig“ ist. Die Sprache dabei? Kalkuliert mies.
Ob das Label „gesichert rechtsextrem“ die Partei schwächt, ist offen. 2026 wird in fünf Bundesländern gewählt, zwei davon im Osten. Wie darauf reagieren? Friedrich Merz lässt CDU/CSU im Februar mit der AfD stimmen. Jens Spahn will sie „normalisieren“. Alexander Dobrindt spricht davon, sie „wegzuregieren“. Das klingt nicht, als hätte man die Zeichen der Zeit erkannt.
Die Brandstifter sind empört
Die Reaktion der AfD? Erwartbar. Sie nennt das Gutachten einen „schwarzen Tag für die Demokratie“ und will klagen. Die thüringische Parteigröße Björn Höcke reagierte mit Drohungen: „Man kann den Angestellten des Verfassungsschutzes nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen (…) Mitgehangen – mitgefangen“, schrieb er auf X – und löschte es wieder. Bemerkenswert auch manche mediale Bewertung. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt: „Eine derart starke Partei wie die AfD als rechtsextrem zu brandmarken, ist ein gewagtes Experiment.“ Als ob der Rechtsstaat taktisch entscheiden sollte, ob ein Verbot der Situation oder mit Blick auf die wachsende Wählerschaft der AfD angemessen ist.
Das Gutachten ist eine Zäsur. Eine klare Einordnung. Es sollte ein letztes Innehalten auslösen. Die AfD, einst eurokritisch gestartet, ist Schritt für Schritt nach rechts außen gerückt. Sie ist keine normale Partei. War es nie. Wird es nie sein. Wer sie als solche behandelt, verharmlost sie. Wer mit ihr kooperiert, legitimiert sie. Wer ihre Wähler pauschal zu Protestwählern erklärt, ignoriert, dass viele mit dem Label „rechtsextrem“ kein Problem (mehr) haben. Dem muss mehr entgegengesetzt werden als symbolische Mahnungen. Es braucht den Bruch mit der weit fortgeschrittenen Normalisierung. Denn zur Disposition stehen Grundprinzipien der Demokratie. Würde die AfD regieren, würde sich Deutschland radikal verändern – und wahrlich nicht nur in der Migrationspolitik. Sondern im Kern.
Fünf Tage nach Veröffentlichung des Gutachtens verlor Friedrich Merz im Bundestag im ersten Wahlgang seine Kanzlerwahl. Eine historische Schlappe. Ein politisches Erdbeben. Der Bundestag ist nicht in der Lage, eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden. Merz, der antritt, das „Richtige für Deutschland“ zu tun, gilt fortan als beschädigt. Die Reaktion? Entsetzen auf der einen Seite. Schadenfreude bei der AfD.
Demokratie stirbt nicht in einem Knall – sondern in Etappen. Wenn wir zuschauen. Wenn wir relativieren. Wenn wir uns an einst Unsagbares gewöhnen. Ein Gutachten wird die AfD nicht stoppen. Ein Verbot, so es denn kommt, wäre kein Allheilmittel. Aber beides sind Prüfsteine. Für den Ernst, mit dem bisherige Selbstverständlichkeiten verteidigt werden. Institutionell, politisch, gesellschaftlich.
Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: gulnerits.kathrin@news.at
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 19/2025 erschienen.