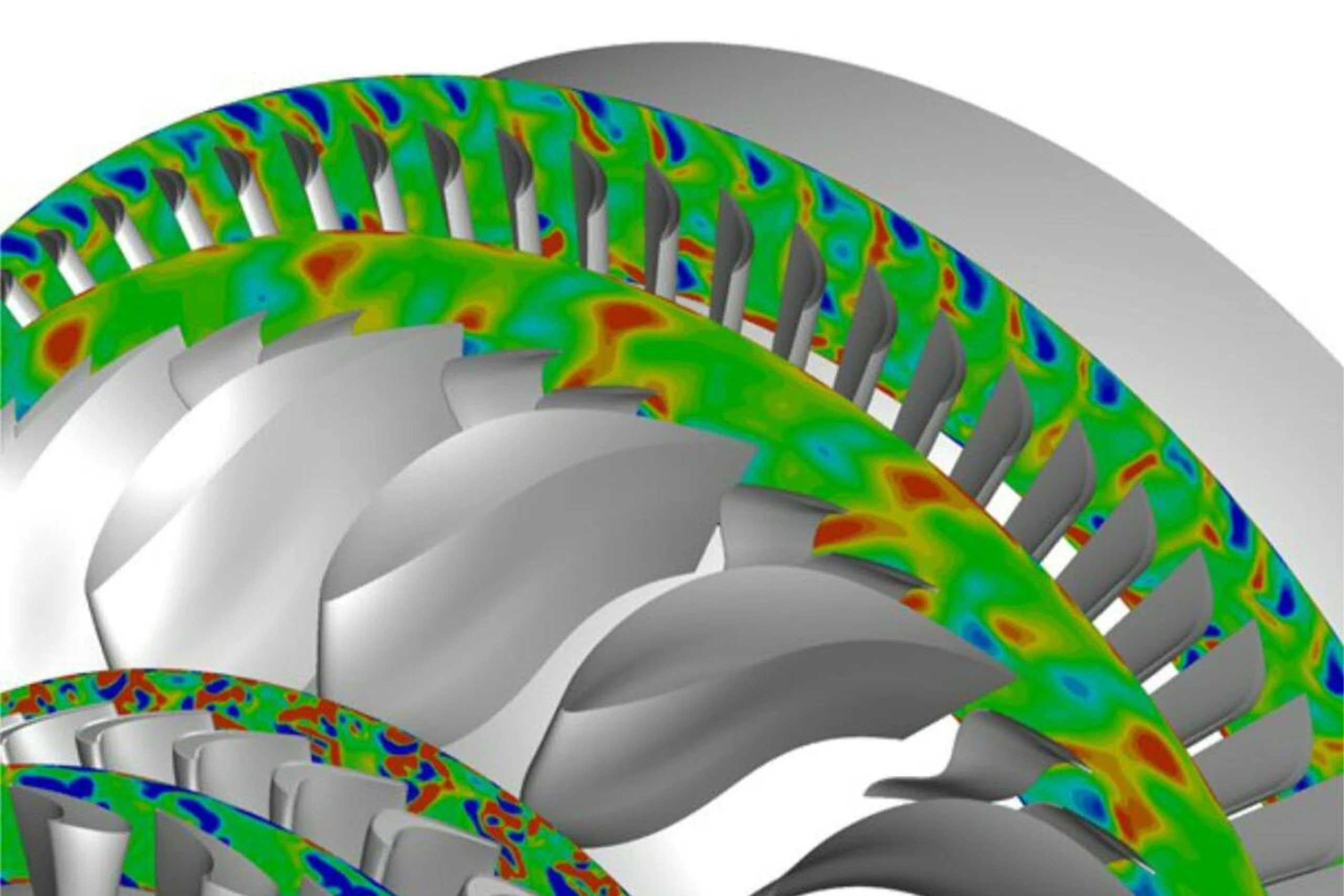von
Das sagte der stellvertretende Direktor des Bundeskriminalamts (BK), Paul Marouschek am Donnerstag bei einem Hintergrundgespräch in Wien. Er beschrieb die Rolle des im BK angesiedelten Cybercrime-Competence-Center (C4) in diesem "positiven Ermittlungsfall" als die eines "professionellen Assistenzdienstleisters". Denn die zentralen Ermittlungen, die zur Identifizierung und Ausforschung von vier Verdächtigen in Deutschland führten, wurden durch Beamte der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zum Erfolg. Sie waren dann auch bei den Razzien in Deutschland beteiligt, wie der stellvertretende DSN-Direktor Leopold Holzbauer bei dem Mediengespräch erläuterte.
Warum insbesondere Österreich für die in Deutschland ansässigen "Swatter" aus der Messengergruppe "Schweinetreff" zum Zielland wurde, wusste einer der DSN-Ermittler zu berichten: "Die interne Kommunikation der Täter zeigte, dass Österreich als Zielland deswegen interessant war, weil die mediale Reaktion hier als sehr hoch angesehen wurde." So gab es etwa Klagen darüber, dass man mit den Bombendrohungen, die sich vor allem gegen Schulen und Bahnhöfe gerichtet hatten, in Deutschland keine entsprechende Resonanz mehr auslösen konnte. Laut Holzbauer waren die Personen hinter den Drohungen anonym in Netzwerken unterwegs: "Es war ein loser Zusammenschluss, bei dem es um die Anerkennung ging", und die Sichtbarkeit in den Medien habe einen gewissen Wettkampfeffekt erzeugt.
Beim laut DSN-Ermittler relativ neuen Phänomen des "Swatting" geht es darum, durch falsche Notfälle polizeiliche Großeinsätze auszulösen und möglichst große mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die nun ausgeforschten Verdächtigen im Alter von 16 bis 23 Jahren agierten dabei sehr professionell, schilderte der Beamte, der verständlicherweise anonym bleiben wollte. Natürlich seien Bombendrohungen an sich kein neues Phänomen, "aber der Charakter eines 'sportlichen Kontextes' im Hintergrund" habe dann durchaus überrascht. Was die Verdächtigen von "Trittbrettfahrern" oder Verursachern von einmaligen Aktionen unterschied, erläuterte BK-Büroleiter Martin Grasel. Demnach hätten sie beim Versenden von E-Mails mit Bombendrohungen oder Androhungen von Amokläufen etwa nicht den eigenen Computer verwendet und seien "technisch insgesamt versierter" vorgegangen - sogar selbst entwickelte, kleinere Software sollen die jungen Männer eingesetzt haben.
Amikal war die Stimmung bei den "Swattern" dabei nicht: "In der Szene selbst gab es keine Freundschaften oder persönliche Beziehungen", schilderte der DSN-Ermittler seine Eindrücke. Es wäre hingegen ein fast feindliches Umfeld gewesen, es habe sogar Fälle von "Doxxing" (die Veröffentlichung privater Daten zur Einschüchterung oder Erpressung, Anmerkung) gegeben und keine Solidarität. Insgesamt habe man es mit einer schnelllebigen Szene zu tun, in der es Einsteiger wie auch Aussteiger gebe, wobei letztere den Ermittlern auch Einblicke lieferten. Die schlechte Nachricht des Ermittlers lautet: "Wir gehen davon aus, dass dieses System bleibt." Jetzt gilt es jedoch erst einmal, sich über den Erfolg zu freuen: Bereits im September 2025 wurden drei Verdächtige durch österreichische Kriminalitätsbekämpfung ausgeforscht, nun steht man bei insgesamt sieben, denen mehr als strafrechtliche 300 Fakten zugeordnet werden.