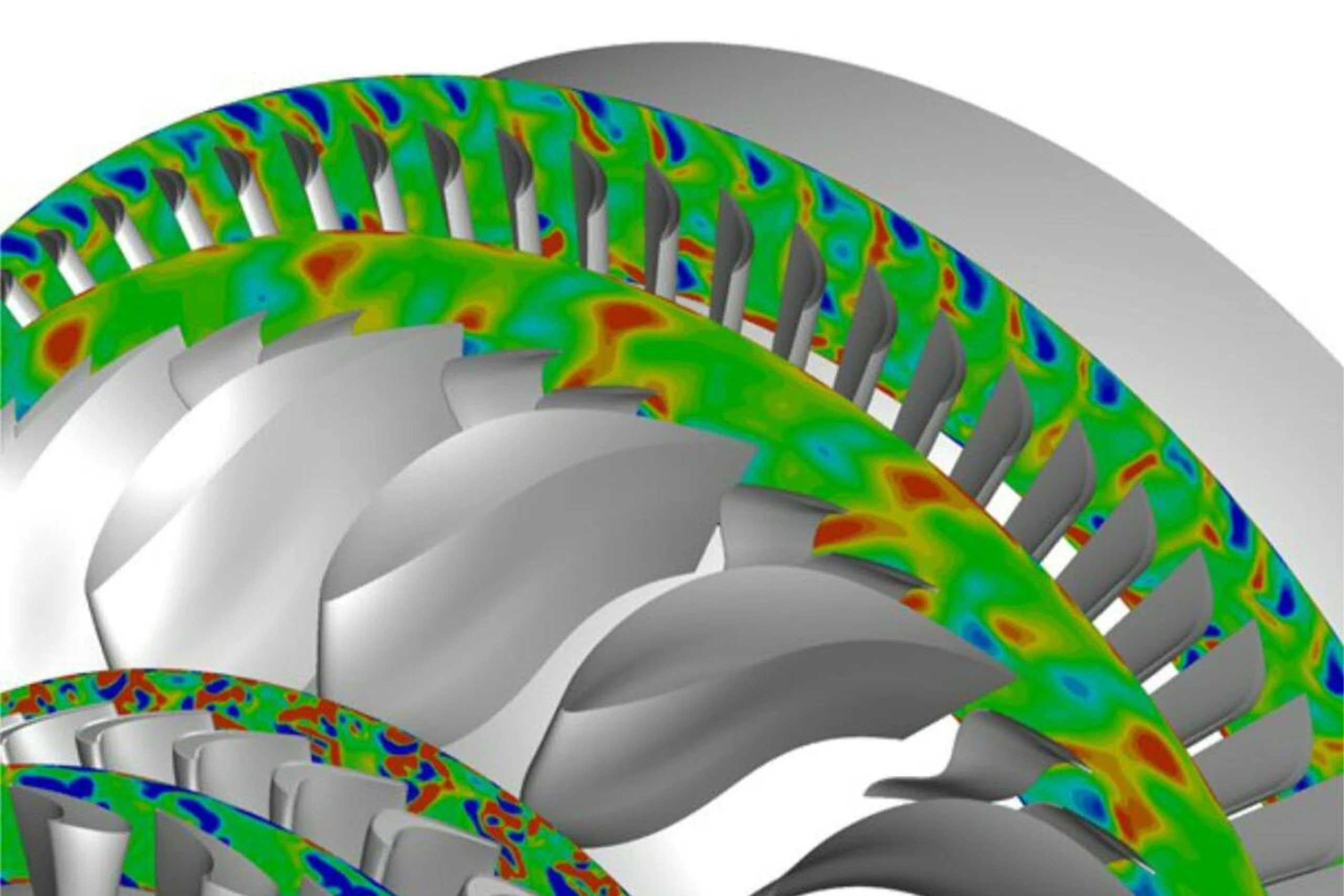von
"Calprotectin selbst war nicht entzündungsfördernd, seine Untereinheiten S100A8 und S100A9 hingegen schon", erklärte der Mediziner. Dabei gelte Calprotectin als klassischer Darm-Entzündungsmarker, anhand dessen man den Schweregrad von Entzündungen im Darm feststellen kann: "Ist der Wert erhöht, spricht das für eine Entzündung", erklärte der Gastroenterologe.
Unter der Leitung von Herbert Tilg, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin, habe man in der Studie jedenfalls nachweisen können, dass die Einzelteile des Moleküls genauere Aussagen auf das Krankheitsbild eines Patienten ermöglichen. Nun möchte man in einer Folgestudie am Menschen versuchen, die Einzelteile von Calprotectin (S100A8 und S100A9) jeweils gezielt zu hemmen. Das würde "ganz neue Therapieansätze eröffnen", betonte Adolph. Es könne in der Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nämlich bald möglich sein, dass "nicht mehr der gesamte Calprotectin-Komplex, sondern direkt die Untereinheiten" gehemmt werden. Man sei jedenfalls auf dem besten Weg, gemeinsam mit Partnern Therapeutika zu entwickeln, welche genau dafür eingesetzt werden könnten, berichtete er.
Die Arbeitsgruppe habe Stuhlproben von fast 700 Betroffenen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen analysiert, betonte indes Almina Jukic, Erstautorin und PhD-Studentin an der Med Uni Innsbruck. "Neben dem bekannten Calprotectin-Komplex haben wir auch Homodimere nachgewiesen", erklärte sie. Das seien Moleküle, die aus zwei gleichen Eiweißbausteinen - etwa zwei S100A8 oder zwei S100A9 Eiweißen - bestehen. Im Gegensatz dazu setze sich der Calprotectin-Komplex aus zwei unterschiedlichen Eiweißen zusammen. Während die Calprotectin-Gesamtwerte bei einigen Patienten mit klinischer und endoskopischer Krankheitsaktivität offenbar unauffällig bzw. niedrig waren, konnten erhöhte Werte von S100A9 im Stuhl nachgewiesen werden, berichtete Jukic. "Das macht S100A9 zu einem vielversprechenden zusätzlichen Marker für die Krankheitskontrolle", sagte sie.
Darüber hinaus hat eine Behandlung mit den getrennten S100A8- oder S100A9-Proteinen Darmentzündungen in experimentellen Versuchen verschlimmert, während dies beim gesamten Calprotectin-Komplex nicht zu beobachten war. Eine genetische Ausschaltung von S100A9 habe bei den Modellen zudem vor Darmentzündungen geschützt und eine medikamentöse Hemmung von S100A9 eine chronische Kolitis verbessert, sagte Jukic.
In Österreich seien indes rund 75.000 Menschen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa betroffen, erklärte indes Adolph. Epidemiologen würden jedoch einen Anstieg auf etwa ein Prozent der Bevölkerung bis 2030 erwarten, sagte er. Weltweit seien bereits jetzt circa 20 Millionen Menschen daran erkrankt.
Diese chronischen und nicht heilbaren Darmerkrankungen würden bei Menschen vor allem "in der zweiten und dritten Lebensdekade diagnostiziert" und begleiten die Patienten dann "bis ins hohe Alter", erklärte der Gastroenterologe. "Wir glauben jedenfalls, dass eine Verwestlichung der Ernährung - mit all den Schadstoffen stark industrialisierter Lebensmittel - ein wichtiger Treiber für diese Entzündungsprozesse im Darm und folglich für chronisch entzündliche Darmerkrankungen ist", meinte Adolph.
Die aktuelle Studie würde indes in Kürze im Fachjournal "Gastroenterology" veröffentlicht werden, betonte der Mediziner. Zurzeit arbeite man jedenfalls an großen Biomarkerstudien, um der Frage nachzugehen, ob dies die Früherkennung einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung oder eines Schubes der Erkrankung hat. Ein nächster Schritt sei dann auch die Entwicklung von Hemmstoffen gegen S100A9 im Rahmen von Kooperationen voranzutreiben, berichtete der Forscher.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/THEMENBILD