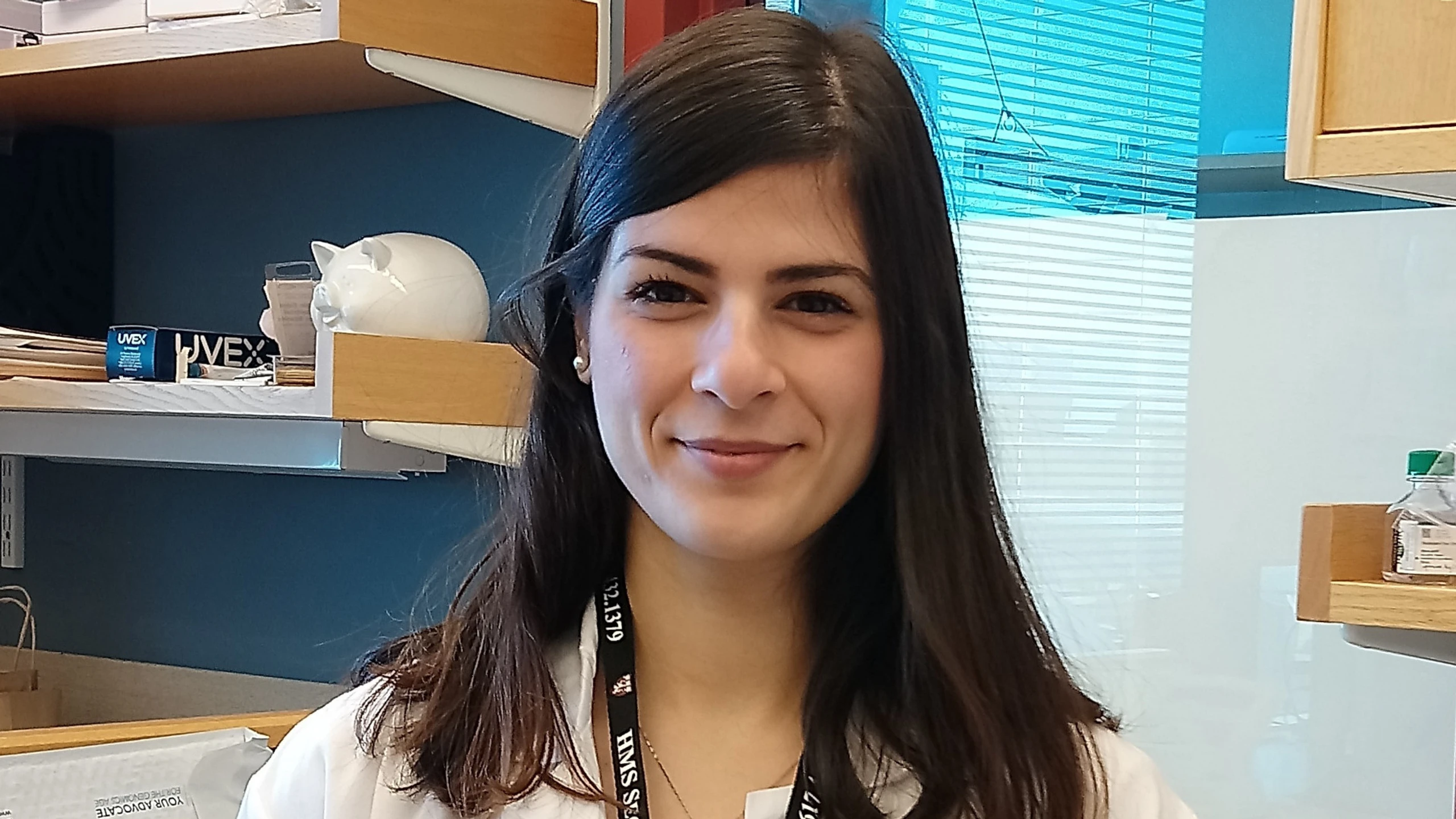Seit dreißig Jahren zählt die belgische Diplomatentochter Amélie Nothomb zu den erfolgreichsten Schriftstellern Frankreichs. Ein Gespräch über ihren Vater, den Helden ihres jüngsten Romans, und warum sie die Genderdebatte nicht interessiert
von
Steckbrief Amélie Nothomb
bürgerlicher Name: Fabienne Claire Nothomb
Geboren am: 9. Juli 1966 in Etterbeek, Brüssel bzw. laut eigenen Angaben 1967 in Kobe, Japan
Aufgewachsen in: Japan, China, New York, Burma und Laos
Lebt in: Paris
Ausbildung: Studium der Romanistik an der Université Libre de Bruxelles
Beruf: Schriftstellerin; ihre Romane sind in 40 Sprachen übersetzt und erreichen allein in Frankreich Auflagen in Millionenhöhe
Familie: Tochter des belgischen Diplomaten Baron Patrick Nothomb († 2020) und der belgischen Adelstochter Danièle Scheyven
Kinder: keine Kinder
Die zwölf Männer sind bereit, das erst 28 Jahre währende Leben ihres Gefangenen auszulöschen. Vier Monate war der junge Mann in ihrer Gewalt, verhandelte über Leben und Tod, erzählte vom Leben seiner Mitgefangenen, bewahrte durch seine Worte Hunderte und sich selbst vor dem Ende. Täglich wurden Gefangene erschossen. Jetzt soll er an der Reihe sein. "Der Tod vor meinen Augen hat das Gesicht der zwölf Vollstrecker", kommentiert der Ich-Erzähler das schreckliche Geschehen.
Was wie ein furioser Hollywood-Thriller anhebt, hat sich tatsächlich so zugetragen. Der junge Mann war der belgische Konsul Baron Patrick Nothomb, der bei seinem ersten Einsatz 1964 mit 1.600 anderen von Simba-Rebellen im Kongo gefangen genommen wurde. Der Fall schrieb als größte Geiselnahme Geschichte. Zwei Jahre nach seiner Freilassung wird sein drittes Kind, heute bekannt als die Weltschriftstellerin Amélie Nothomb, geboren. Patrick verstarb im März 2020. Was ihr Vater in den Schreckensmonaten erlebt hat, wie er in einer konservativen Adelsfamilie aufwuchs, erzählt seine Tochter meisterhaft in "Der belgische Konsul" (Diogenes).
News erreichte sie in Paris zum fernmündlichen Gespräch über eine wundersame, literarisch vielfach beglaubigte Vater-Tochter-Beziehung.
Vater-Tochter-Beziehungen sind ein zentrales Thema Ihres Schaffens. Im aktuellen Roman schreiben Sie über Ihren Vater. Wie war das, als Ich-Erzähler die Geschichte des eigenen Vaters zu reflektieren?
Das ist kein Buch über meinen Vater, das ist ein Buch von meinem Vater. Als ich noch ein kleines Kind war, sagten die Leute: "Schau, das ist Patrick", wenn sie mich gesehen haben. Das war mir unangenehm, denn ich wusste nicht, was die Leute damit meinten. Aber wenn meine Eltern Gäste hatten, sagte ich selbst: "Bonjour, ich bin Patrick." Jetzt, seit dem Tod meines Vaters, weiß ich, dass diese Leute damals recht hatten. Es ist wahr, ich bin Patrick. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel man von seinem Vater in sich hat. Auch Proust schreibt darüber in Bezug auf seine Mutter.
Wann starb Ihr Vater?
Am 17. März 2020, das ist auch noch der Tag des heiligen Patrick. Das war schon eigenartig. Das war der erste Tag des Lockdowns. Ich denke, mein Vater hat sich diesen Tag ausgesucht, denn er hätte den Lockdown niemals ertragen.
Hatte Ihr Vater auf dem Schloss seiner Familie in Belgien nicht gewisse Freiheiten?
Er lebte in den Ardennen, auf dem Anwesen unserer Familie am Fuße des Schlosses. Er gab sehr gern Empfänge, deshalb hätte er den Lockdown nicht ertragen. Übrigens, die Berichte, er sei an Covid gestorben, sind Fake News, er hatte Krebs.
Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?
Das war ganz sonderbar. Am 9. März 2020, genau acht Tage vor seinem Tod. Ich habe ihm nie gesagt, dass ich ihn liebe. Ich weiß nicht, was damals über mich gekommen ist, ich denke, das war eine Intuition. Denn als ich mich von ihm verabschiedete, sagte ich: "Auf Wiedersehen, Papa, ich liebe dich." Und er sagte: "Auf Wiedersehen, Amélie, ich liebe dich." Auch er hat das noch nie zu mir gesagt. Heute bin ich sehr erleichtert, dass ich ihm das gesagt habe. Die Nachricht von seinem Tod war ein schrecklicher Schock für mich. Es hätte einer Revolution bedurft, dass ich zu seiner Beerdigung hätte gehen können. Denn die Grenzen waren geschlossen. Mein Vater hatte Kontakte zum belgischen Heer. Ich fragte, ob mich jemand über die Grenze schleust, aber niemand hat mir eine Ausnahme gewährt. Mein Schmerz wurde immer größer. Sechs Monate später begann ich diesen Roman, und ich wusste, es sollte kein Buch über, sondern ein Buch von meinem Vater werden.
Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel man von seinem Vater in sich hat
Ihr Vater hat doch ein eigenes Buch geschrieben.
Eine großartige Dokumentation darüber, was in den 60er-Jahren im Kongo passiert ist. Aber er schrieb kein einziges Wort über sich selbst. Die Geiselnahme ist bei ihm eine nüchterne Wiedergabe von Fakten. Ich hatte aber nicht den Mut, ihn näher dazu zu befragen, und ich bin sicher, er hätte mir nicht geantwortet.
Im französischen Original nennen Sie den Roman "Premier sang" ("Erstes Blut").
Der Titel ist ein Begriff aus der Zeit der Duelle. Der bedeutete, dass man nur so lange kämpft, bis das erste Blut fließt, aber nicht bis zum Tod des Gegners. Mein Vater hatte eine Hämaphobie, das heißt, er wurde ohnmächtig, wenn er einen Blutstropfen sah. Das änderte sich nie. Aber das zeigt noch mehr seinen Heldenmut, denn in Geiselhaft war er ständig mit dem Blut der Getöteten konfrontiert, und seinen scharfen Verstand. Denn er erklärte den Geiselnehmern, er würde aus Respekt vor den Seelen der Toten wegschauen. Hätte er sich nur eine Blöße gegeben, wären wahrscheinlich alle umgekommen.
Haben Sie durch die Arbeit an diesem Buch auch etwas über sich selbst erfahren?
Ja, sicher, weil ich begriff, warum ich geboren wurde. Ich kannte diese Geschichte, habe aber ihren tieferen Sinn nicht verstanden. Dieses Buch hat ihn mir erklärt. Ich bin in Todesnähe geboren, aus dem Wunsch eines Überlebenden.
Ihr Vater konnte die Geiselnehmer wie eine Art Scheherazade durch seine Erzählungen davon abhalten, ihn zu töten. Man kann sagen, er erzählte, um zu überleben. Ist das bei Ihnen ähnlich?
Da könnten Sie recht haben. Ich denke, auch ich schreibe, um zu überleben. Das zeigt noch mehr meine Ähnlichkeit mit meinem Vater. Aber ich kann Ihnen sagen, meine Eltern und meine Geschwister ausgenommen, schätzt niemand aus der Familie meine Bücher. Das ist eine katholische, reaktionäre Familie. Die halten mich für eine skandalöse Person, für die man sich schämen müsse.
Warum wurde Ihnen der Titel Baronesse vom belgischen König verliehen? Der steht Ihnen als Tochter eines Barons doch zu, nicht?
In Belgien darf eine Frau diesen Titel nur tragen, wenn sie verheiratet ist. Ich finde das ungerecht. Aber meinen Verwandten war es unangenehm, dass ich diesen Titel bekam.
Sie schreiben, dass die Nothombs Ihre Mutter ablehnten, weil sie nur von einem Ritter abstammt.
Belgien ist ziemlich retro, wenn es um Klassenbewusstsein geht. Deshalb wurde mein Vater Diplomat. Er wollte nicht, dass meine Mutter dieser Familie ständig ausgesetzt ist.


Amélie Nothomb wollte schon als Kind Schriftstellerin werden.
© imago images/Jason CarrIhr Vater hatte eine große Affinität zur Literatur. Hat er Sie zum Schreiben gebracht?
Ich war neun, als mir mein Vater Rimbaud zum Lesen gab, das war schwierig, aber sehr schön. Den Hang zur Literatur habe ich von ihm. Aber wenn man Literatur für etwas Besonders hält, heißt das nicht, dass man zwingend Schriftsteller werden muss. Rainer Maria Rilke gab mir den Anstoß zum Schreiben. Als ich Rilkes "Briefe an einen jungen Dichter" las, spürte ich, dass auch ich Schriftsteller werden könnte.
Ihr Urgroßvater, Baron Pierre Nothomb, war auch Dichter.
Ich hoffe, dass meine Romane besser sind als seine Gedichte. Pierre Nothomb war im Belgien der 40er- und 50er-Jahre eine Berühmtheit. Ich behandle Pierre Nothomb im Buch sehr, sehr gut, aber in Wirklichkeit war er kein guter Mensch. Er stand politisch auf der falschen Seite und hatte den Ehrgeiz, der größte katholische Dichter seiner Zeit zu sein, war aber immer hinter Frauen her und hatte viele Affären. Er hatte diese Gedichte geschrieben, um Gott um Verzeihung zu bitten.
Wollten Sie wegen dieses Urgroßvaters Ihre ersten Romane nicht unter dem Namen Nothomb veröffentlichen?
Ich hatte keine große Lust, diesen Namen weiterzuführen, und wollte mich Amélie Cassis-Bellie nennen. Aber mein Verleger meinte, der Name würde nicht funktionieren und Belgien sei ihm egal. Jetzt wissen die Leute in Belgien bald nicht mehr, wer Pierre Nothomb war, und Amélie Nothomb ist bekannter als Pierre Nothomb.
Wie kam es, dass die Kinder der adeligen Nothombs in den 50er-Jahren zu wenig zu essen hatten?
Belgien auf dem Land in den 40er-, 50er-Jahren, das war wie Dickens. Da hatten Kinder keinen Wert. Das war in aristokratischen Familien noch schlimmer. Wenn ein Kind gestorben ist, war das Schicksal.
Mit fällt auf, dass Sie auf weibliche Endungen keinen Wert legen. Ist das Ihre Antwort auf die Genderdebatte, die derzeit auch in Frankreich immer heftiger geführt wird?
Ich sage, ich bin Schriftsteller. Es ist mir egal, ob man mich als Schriftstellerin oder als Schriftsteller bezeichnet. Denn Ich nehme an dieser Diskussion nicht teil, das interessiert mich nicht.
Das Buch
Die ersten 28 Jahre ihres Vaters verdichtet Amélie Nothomb in "Der belgische Konsul" * zu einem furiosen Thriller. Diogenes, € 23,90
Dieses Interview erschien ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 27/2023.
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen solchen klicken und über diesen einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.