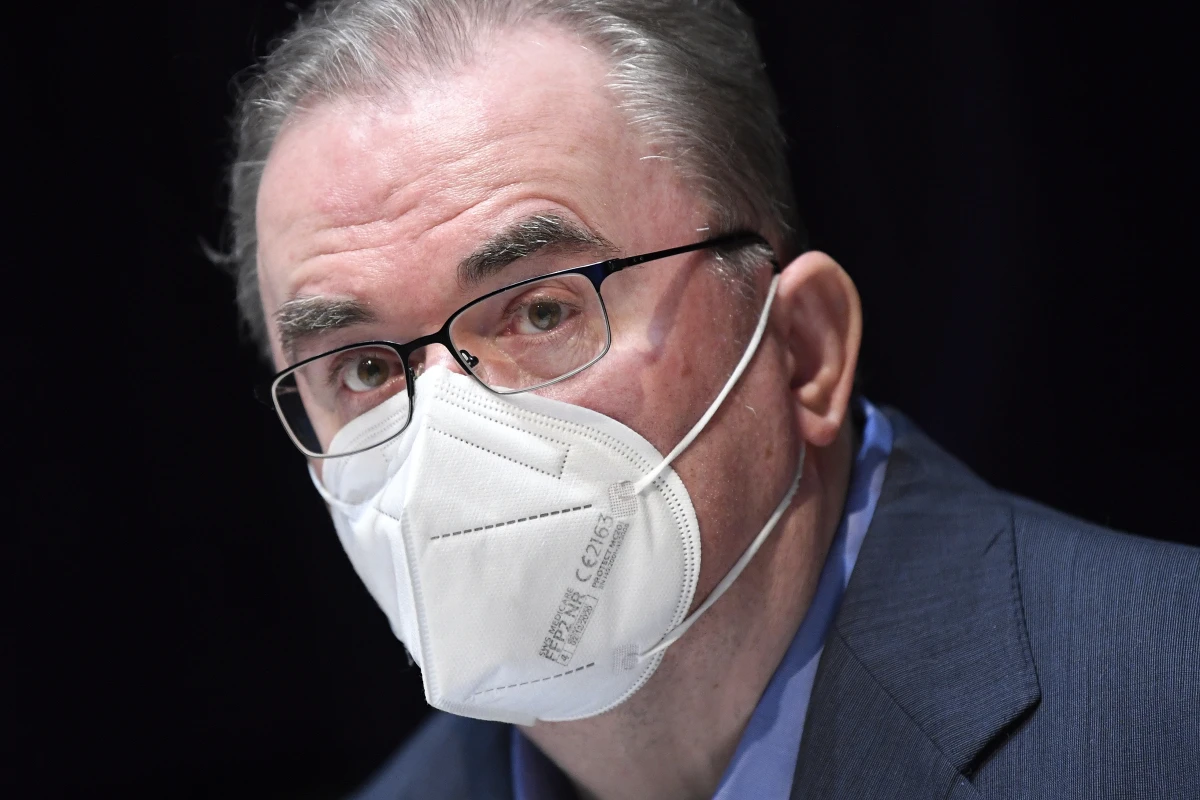von
Die Flaute am Bau betreffe "Österreich - und Deutschland noch ärger", berichtete Bursik, der bei Baumit für beide Länder zuständig ist. "Österreich hat ja das Problem, dass überhaupt nicht gebaut wird, obwohl wir Zuzug haben", skizzierte er die Situation plakativ. "Der Neubau steht - seit 15 Jahren wurden nicht so wenig Wohnungen fertiggestellt wie jetzt", so Bursik. Schon zu Beginn des Jahres hatte er appelliert, dass wieder mehr gebaut werden müsse - wenn möglich halbwegs leistbar. Um den steigenden Bedarf zu decken, sollten seinen Angaben zufolge jährlich zwischen 40.000 und 60.000 Wohneinheiten errichtet werden. Von dem Ziel war man da noch um etwa 40 Prozent entfernt.
Das Geschäft mit Zement, Beton und Baustoffen läuft schleppend. Und das bisschen Mehr im Sanierungsbereich wiege den Rückgang im Neubau nicht auf, sagte der Unternehmenschef. Hierzulande gibt es seinen Angaben zufolge über zwei Millionen Gebäude, "die saniert gehören, die dem wärmetechnischen Standard nicht entsprechen, die viel Heiz- und Kühlenergie verbrauchen". Klimatechnische Verbesserungen kommen seiner Ansicht nach nicht schnell genug voran. "Wenn wir in dem Tempo weitermachen, haben wir die zwei Millionen Häuser in 100 Jahren nicht saniert", vermerkte Bursik.
Die Regierung evaluiert derzeit alle Klima- und Umweltförderungen. Angesichts des immensen Budgetdefizits soll die staatliche Förderung für die thermische Sanierung zwar fortgeführt, aber deutlich gekürzt werden. Ab wann wieder Geld fließt, ist noch offen. Laut Umweltministerium wird sich die Förderquote künftig bei 30 Prozent einpendeln - bis Ende 2024 waren 75 Prozent der Kosten für den Tausch von Öl- und Gasheizungen gefördert worden.
"Die Förderung ist ja relativ abrupt mit Dezember stillgelegt worden", monierte der Baumit-Chef. Dabei trage die Förderung in weiterer Folge zum heimischen Bruttoinlandsprodukt bei und erhalte beziehungsweise schaffe Arbeitsplätze, zählte er als Vorteile des staatlichen Mittelflusses auf. Außerdem würden durch eine verstärkte Sanierung Strafzahlungen nach Brüssel vermieden, die zu leisten sind, wenn die CO2-Ziele der EU nicht erreicht werden. "Da ist es besser in Österreichs Wirtschaft zu investieren", meinte Bursik.
"Der Sektor Gebäude ist der zweitgrößte CO2-Emittent, nach dem Verkehr", strich der Linzer Ökonom Friedrich Schneider hervor. Die Sanierungsoffensive für Private in den Jahren 2023 und 2024 - mit dem Sanierungsbonus für die "Einzelbauteilsanierung Außenwände" und dem Programm "Raus aus Öl und Gas", mit dem der Kesseltausch von Fossil auf Wärmepumpe gefördert wurde, sei "sehr gut angenommen" worden. Derzeit warten die Konsumentinnen und Konsumenten ab, wie es mit den Förderungen weitergeht. Der Markt steht praktisch still.
Schneider unterstrich die Vorteile der staatlichen Stützung. "Es kommt doch ein ganz beträchtlicher volkswirtschaftlicher Effekt heraus - da es der Wirtschaft nicht so gut geht, ist das ein angenehmer Nebeneffekt", so der Volkswirt. Die in Summe gut 1,5 Mrd. Euro an Fördergeldern, die zuletzt in die thermische Sanierung geflossen seien, hätten Investitionen in Höhe von 5 Mrd. Euro ausgelöst - bei den 801 Mio. Euro Bundesförderung für Fassaden und Fenster seien es 3,5 Milliarden gewesen, bei den 739 Mio. Euro für den Heizkesseltausch 1,5 Milliarden. "Das Programm rechnete sich", stellte Schneider fest. Der Staat mache sowohl wirtschaftspolitisch als auch ökologisch etwas Sinnvolles. Er habe auch Rückflüsse durch Steuereinnahmen.
"Und es ist ja noch nicht abgeschlossen- gerade bei der Fassadensanierung, aber auch beim Kesseltausch ist noch enorm viel zu tun, sodass man dieses Programm weiterführen sollte", meinte der Volkswirt, der jahrelang an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz unterrichtet hatte. Über Förderungen könne man immer streiten. "Unser Budget ist aus den Fugen geraten, also müssen wir entsprechend sparen." Die Frage sei, wo man die höhere ökologische und/oder ökonomische Dividende sehe, wenn es um die Kürzung von Fördermaßnahmen gehe. "Aus früher möglicherweise guten Gründen fördern wir Dinge, die wir nicht mehr fördern müssten", kritisierte Schneider.
"Staatliche Förderungen sind nur gerechtfertigt, wenn es zur Verringerung der negativen externen Effekte beiträgt", hielt der Ökonom fest und verwies betreffend thermischer Sanierung auf weniger CO2-Emissionen und den geringeren Importbedarf von fossilen Energieträgern. Das große Gegenargument gegen Förderungen sei "der sogenannte Mitnahmeeffekt". Etwa 30 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher hätten die baulichen Maßnahmen auch ohne Geld vom Staat durchgeführt. Alles in allem hält Schneider aber Förderungen für die thermische Sanierung sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich für sinnvoll. Die von ihm angeführten Daten und Erkenntnisse sind das Ergebnis einer Studie, die er im Auftrag von Baumit erstellt hat.
Bei Fortsetzung der Förderungen empfiehlt Schneider aber differenziertere Kriterien für die Verteilung der Gelder anzuwenden. Denn klar sei: "Wir müssen sparen." Bei künftigen Zahlungen könnten etwa besonders schlechte Fassaden oder besonders alte Heizungen zuerst in den Genuss von Förderungen kommen, schlug der Ökonom vor.
Auch Bursik ist der Meinung, dass an der Ausgestaltung etwas gefeilt werden könnte. "Sinnvoll wäre es, den Fördertopf aufzusplitten", meinte er. Die Mittel für thermische Sanierungen und Heizkesseltausch sollten seiner Meinung nach aus unterschiedlichen Fördertöpfen gespeist werden, um Konkurrenz zwischen den beiden Förderungen hintanzustellen. Der Baustoff-Chef empfiehlt eine Fifty-fifty-Aufteilung der Summe. Wärmepumpen machen laut Bursik zudem nur Sinn, wenn der Strom aus erneuerbarer Energie wie Windrädern oder Wasserkraft kommt.
Weiters solle nach dem Prinzip "Zuerst dämmen, dann Heizungstausch" gefördert werden. "Bisher wurde das Pferd von hinten aufgezäumt", merkte der Unternehmenschef an. Die Förderung des Heizkesseltausches kam bei der Bevölkerung gut an. "Aus meiner Sicht war die Lobbying-Arbeit der Wärmepumpe recht gut", bekräftigte Schneider.
(Das Gespräch führte Birgit Kremser/APA)
ARCHIV - 13.02.2020, Niedersachsen, Hannover: Eine Gebäude wird errichtet, während am Horizont die Sonne aufgeht. (zu dpa: «Mehr neue Wohnungen in Bayern genehmigt») Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++