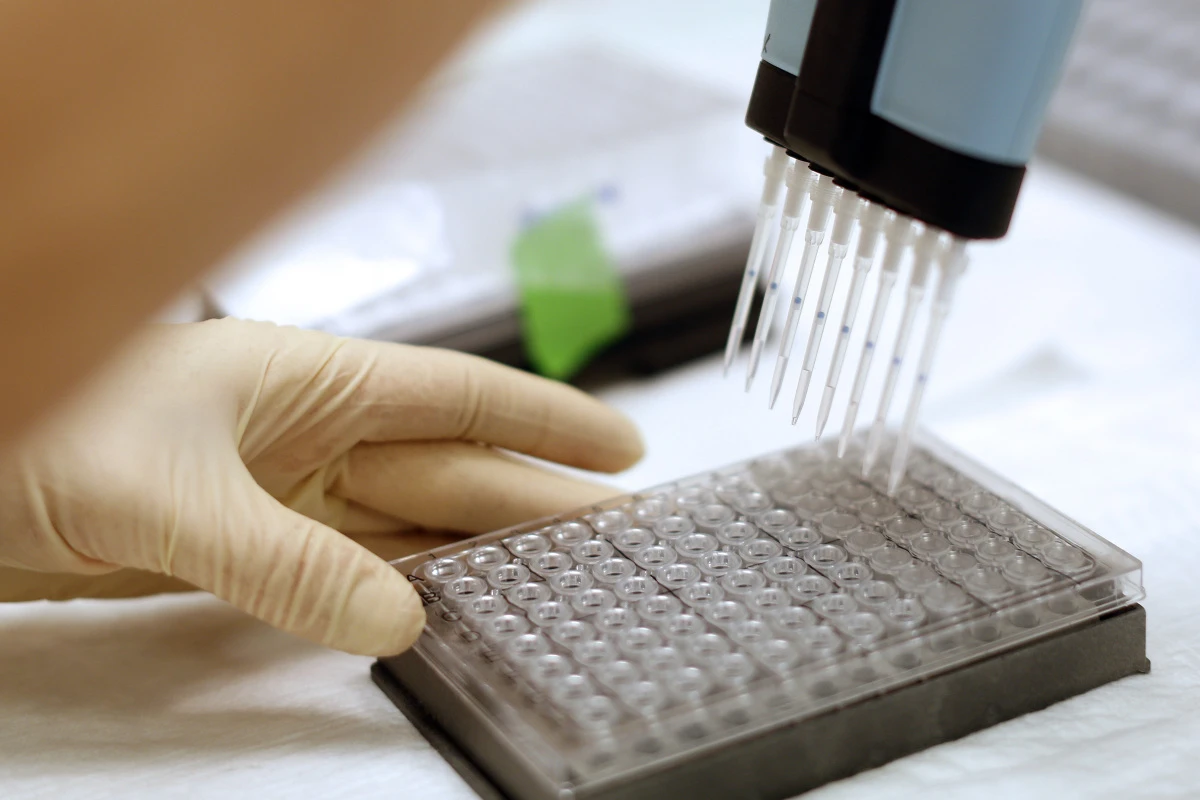von
Im Rahmen des Projekts "Sensus" berechnete das Forschungsteam mithilfe hochauflösender Stadtklimamodelle die Wirkung verschiedener Anpassungsmaßnahmen unter zukünftigen Klimaszenarien. Dabei wurden, wie es in einer Aussendung hieß, nicht nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind berücksichtigt, sondern auch Bebauung, Geländeform und Landnutzung.
Für ein dicht bebautes Stadtgebiet in Wien simulierte das AIT mit einem Mikroklimamodell in zwei Meter Auflösung die Effekte von Maßnahmen wie Baumpflanzungen, entsiegelten Parkplätzen, Dach- und Fassadenbegrünung, hellen Pflastersteinen und Nebelduschen. Das Ergebnis: Unter den angenommenen Bedingungen kühlten naturbasierte Maßnahmen die Umgebung lokal um bis zu zwei Grad Celsius ab – vergleichbar mit einem Höhenunterschied von rund 300 Metern. Besonders effektiv waren Bäume und Entsiegelungen.
Geosphere Austria übertrug diese Ergebnisse anschließend auf die gesamte Stadt. Laut der Stadtklima-Expertin Maja Zuvela-Aloise könnten durch eine umfassende Umsetzung die Hitzetage in Wien um mehr als zehn Prozent sinken. "Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass naturbasierte und realistisch umsetzbare Lösungen die Auswirkungen der Klimaerwärmung deutlich dämpfen können", betonte sie. In der Klimaperiode 1991 bis 2020 verzeichneten dicht bebaute Stadtteile Wiens im Schnitt 78 Sommertage (mindestens 25 Grad) und 24 Hitzetage (mindestens 30 Grad) pro Jahr.
THEMENBILD ++ Illustration zum Thema Hitze / Sommer / Wetter / Klima aufgenommen in einem Dachgarten am Donnerstag 25. Juli 2019 in Wien.