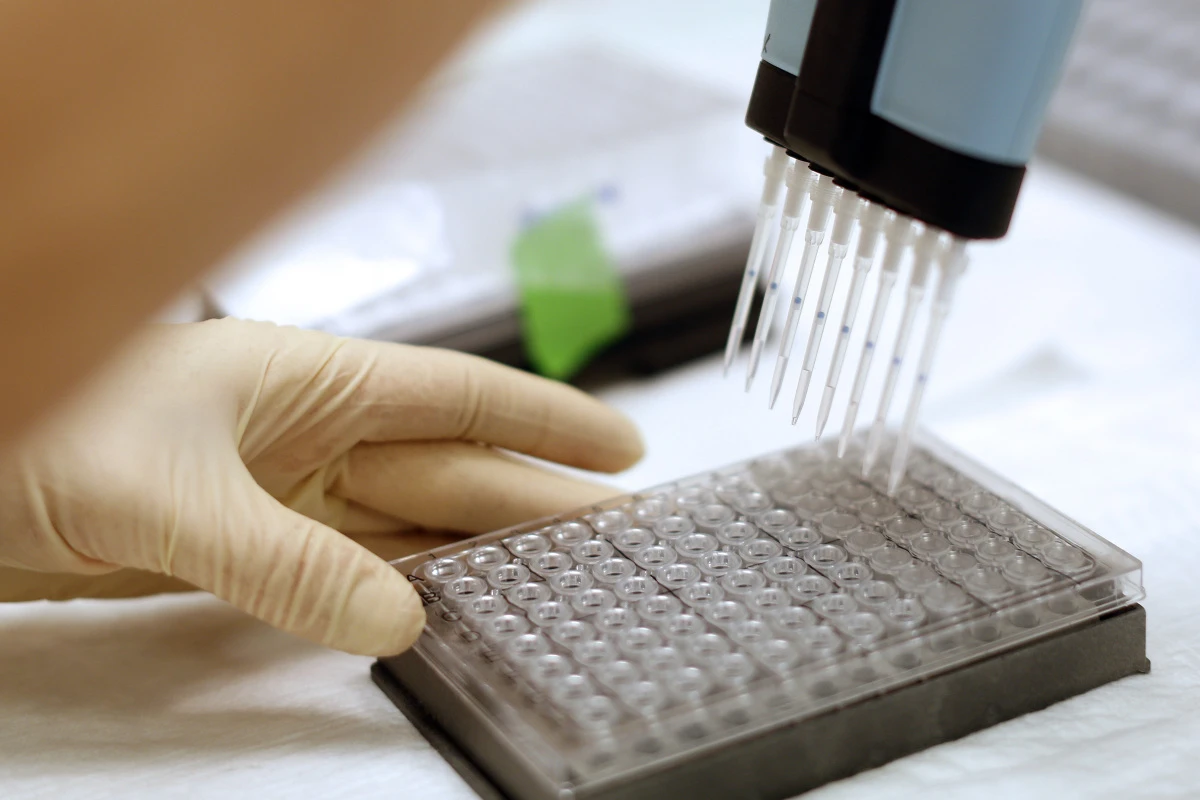von
Werden nach Interessensabwägung Eingriffe in "wertvolle natürliche Lebensräume" trotz "schwerwiegender Schädigungen" behördlich zugelassen, braucht es etwa nach der Ausgleichsmaßnahmenverordnung des oberösterreichischen Naturschutzgesetzes eine Bewilligung. Für derartige (Ausnahme)Fälle aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesses (Straßenbau, Starkstromleitungen) schreibt die Landesregierung zur Abgeltung Ausgleichsmaßnahmen vor. Diese sind ausschließlich in natura zu leisten.
Für alle Projekte, bei deren Umsetzung möglicherweise erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, sieht das UVP-Gesetz ebenfalls Kompensationsmaßnahmen vor. Grundsätzlich muss der Projektant bereits mit Einreichen der Umweltverträglichkeitserklärung eine Ausgleichsfläche bekannt geben sowie die "Wirkungsziele" beschreiben. Seit der Novelle 2023 kann auch nur ein Konzept für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen genehmigt werden.
Ausgleichsflächen haben in "einem funktionalen, räumlichen und zeitlichen Bezug zum beeinträchtigten Schutzgut" zu stehen, wurde 2016 in der Studie "Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft" festgehalten. Die Umweltanwaltschaften Burgenland, Nieder- und Oberösterreich hatten sie in Auftrag gegeben. Eine derartige Kompensation ist zum Beispiel dann nötig, wenn ein Bauprojekt in einem Wildtierkorridor entstehen soll. Für den Erhalt des Korridors dürfe die Umleitung für die Tiere nicht zu weit entfernt sein, nennt Niederösterreichs Umweltanwalt Thomas Hansmann ein Beispiel.
Bei Ersatzflächen hingegen gilt ein "gelockerter funktionaler, räumlicher und zeitlicher Bezug zwischen dem Eingriff und der Kompensation". Wenn zum Beispiel für Pflanzen ein neuer passender Standort gefunden werden muss, sei die Entfernung des Ersatzes nicht das entscheidende Kriterium, aber die neue Fläche hat mindestens gleichwertig zu sein, führt die Umweltrechtlerin an der Linzer Johannes Kepler Uni, Erika Wagner, aus.
In der Novelle des UVP-Gesetzes, die Verfahren besonders für Vorhaben Erneuerbarer Energie beschleunigen will, ist die Möglichkeit enthalten, dass der Projektant auf Vorratsflächen zurückgreifen kann, "soweit dies durch Landesgesetz festgelegt ist". Für die Bereitstellung geeigneter Flächen im Rahmen der UVP sind nämlich generell die Länder zuständig.
Laut UVP-Recht können nun zum Kompensieren vorhandene Flächenpools herangezogen werden. Darin werden Grundstücke gesammelt, ökologisch aufgewertet und bei Bedarf als Ausgleichsflächen bereitgestellt. Allerdings bestehe "ein Manko an landesgesetzlichen Vorgaben für die Realisierung, Überwachung und Verwaltung", hält Wagner fest.
++ ARCHIVBILD/THEMENBILD ++ Projekt Zukunftsbild: Mooren kommt in Zeiten des Klimawandels eine besonders große Bedeutung als Wasserrückhalt, CO2-Speicher und für die Biodiversität zu. Ein Beispiel dafür, wie die Renaturierung eines Moors bzw. einer Moorlandschaft gelingen kann, ist das Moor Salgenreute, das in den nächsten 20 bis 30 Jahren in seinen Originalzustand versetzt werden soll. Im Bild: Ein angelegter Grenzgraben im Salegenreuter Moor in Krumbach im Bregenzerwald, der bereits mit Wasser gefüllt ist und sich Schwimmmoose bilden, die die Gräben in etwa 20 Jahren wieder schließen werden, aufgenommen am 5. August 2024. (ARCHIVBILD VOM 5.8.2024)