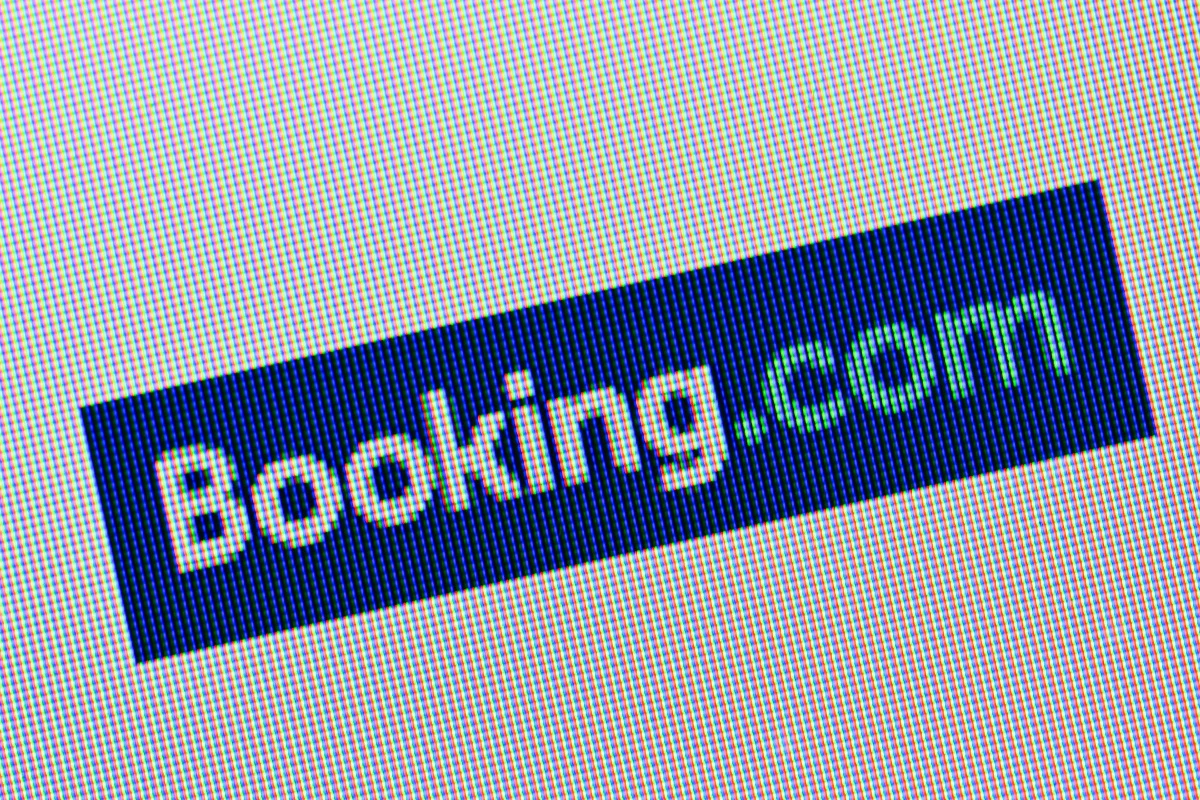von
Er werde seine Zollpolitik vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten legitimieren lassen, kündigte der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social an. "Nun werden wir sie mit Hilfe des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten zum Wohle unserer Nation einsetzen und Amerika wieder reich, stark und mächtig machen!". Weiters betonte Trump auf Truth Social: "Alle Zölle sind weiterhin in Kraft!".
Der Präsident bezeichnete das Berufungsgericht als parteiisch. Wenn diese Zölle abgeschafft würden, wäre das eine totale Katastrophe für das Land, schrieb der Republikaner. Die Vereinigten Staaten von Amerika würden dadurch "buchstäblich zerstört" werden. Auch US-Justizministerin Pam Bondi kündigte an, Berufung gegen das Urteil einzulegen.
Der US-Präsident hatte im April unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Strafzölle gegen zahlreiche Staaten verhängt und dadurch Streit mit Handelspartnern weltweit ausgelöst. Wie sich das Urteil auf den Handel mit Staaten auswirkt, mit denen bereits ein Abkommen geschlossen wurde, war zunächst unklar.
Die Entscheidung ist jedoch ein harter Schlag für den Präsidenten, der Zölle als wirtschaftspolitisches Instrument eingesetzt hatte, und ein großer Dämpfer für diese aggressive Handelspolitik. Sie könnte auch Auswirkungen auf Handelsabkommen haben, die Trump im Zollstreit mit einigen Handelspartnern, etwa der EU, erzielt hat. Betroffen sind unter anderem die im April im Rahmen seines Handelskriegs erlassenen Aufschläge als auch Abgaben auf Importe aus China, Kanada und Mexiko vom Februar.
Bereits am 28. Mai hatte der US-Gerichtshof für internationalen Handel mit Sitz in New York gegen Trumps Zollpolitik entschieden. Dem dreiköpfigen Gremium gehörte auch ein Richter an, der von Trump in seiner ersten Amtszeit ernannt worden war. Auch ein anderes Gericht in Washington hat geurteilt, dass das IEEPA-Gesetz die Zölle nicht erlaubt.
Dagegen wehrte sich die Trump-Regierung vor dem Berufungsgericht. Dieses hob die Blockade des New Yorker Gerichts zwar zunächst vorerst auf, um den Fall zu prüfen. Mit seinem Beschluss hält das Berufungsgericht die Entscheidung der unteren Instanz nun aber in großen Teilen aufrecht, auch wenn es die Zölle nicht direkt untersagt.
Die Urteile beziehen sich auf die von Trump erstmals Anfang April angekündigten länderspezifischen Zölle, die Dutzende Handelspartner der USA betreffen. Danach räumte die US-Regierung Fristen ein, damit die Länder weiter mit den USA verhandeln können. In der Folge veränderten sich einige der Zollsätze. Im Falle der Europäischen Union zum Beispiel gilt seit dem 7. August ein Zollsatz von 15 Prozent auf den Import der meisten EU-Produkte in die USA.
"Das Gesetz räumt dem Präsidenten zwar erhebliche Befugnisse ein, um auf einen ausgerufenen nationalen Notstand zu reagieren", hieß es am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Urteilsbegründung. "Aber keine dieser Maßnahmen schließt ausdrücklich die Befugnis ein, Zölle, Abgaben oder Ähnliches zu erheben oder die Befugnis, Steuern zu erheben." Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor.
Nicht von der Entscheidung betroffen sind Zölle, die auf anderer rechtlicher Grundlage erlassen wurden, wie etwa die Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte. Es wird allgemein erwartet, dass der Fall vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen wird.
Trump hatte die Zölle mit dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977 begründet. Dieses Gesetz ermächtigt den Präsidenten, auf "ungewöhnliche und außerordentliche" Bedrohungen während eines nationalen Notstands zu reagieren. Zölle werden darin jedoch nicht erwähnt. "Es sei unwahrscheinlich, dass der Kongress bei der Verabschiedung des IEEPA beabsichtigt hatte, von seiner bisherigen Praxis abzuweichen und dem Präsidenten eine unbegrenzte Zollbefugnis zu erteilen", hieß es in dem Urteil weiter.
Trump hatte im April wegen des Handelsdefizits der USA einen nationalen Notstand ausgerufen. Die im Februar verhängten Zölle gegen China, Kanada und Mexiko hatte er damit begründet, dass diese Länder nicht genug gegen den Schmuggel von Fentanyl unternähmen.
Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, die für die USA ein nationales Sicherheitsrisiko darstellten - deshalb gebe es einen nationalen Notstand, der die Zölle rechtfertige.
Zölle müssen in der Regel zwar vom US-Parlament genehmigt werden. Trump argumentierte jedoch, dass Handelsdefizite mit anderen Ländern ein nationales Sicherheitsrisiko seien und damit ein nationaler Notstand bestehe. Mit dieser Begründung verhängte er die Zölle - umging das Parlament.
Geklagt hatten fünf kleine US-Unternehmen sowie ein Dutzend US-Bundesstaaten vor dem Gericht in New York - zehn von ihnen werden von den Demokraten regiert, zwei von Trumps Republikanern. Die Befugnis, Steuern, Zölle und Abgaben zu erheben, liege laut US-Verfassung beim Kongress, nicht beim Präsidenten, argumentierten die Kläger. Die nationale Handelspolitik dürfe nicht von dessen Launen abhängen. Insgesamt sind mindestens acht Klagen gegen Trumps Aufschläge anhängig.