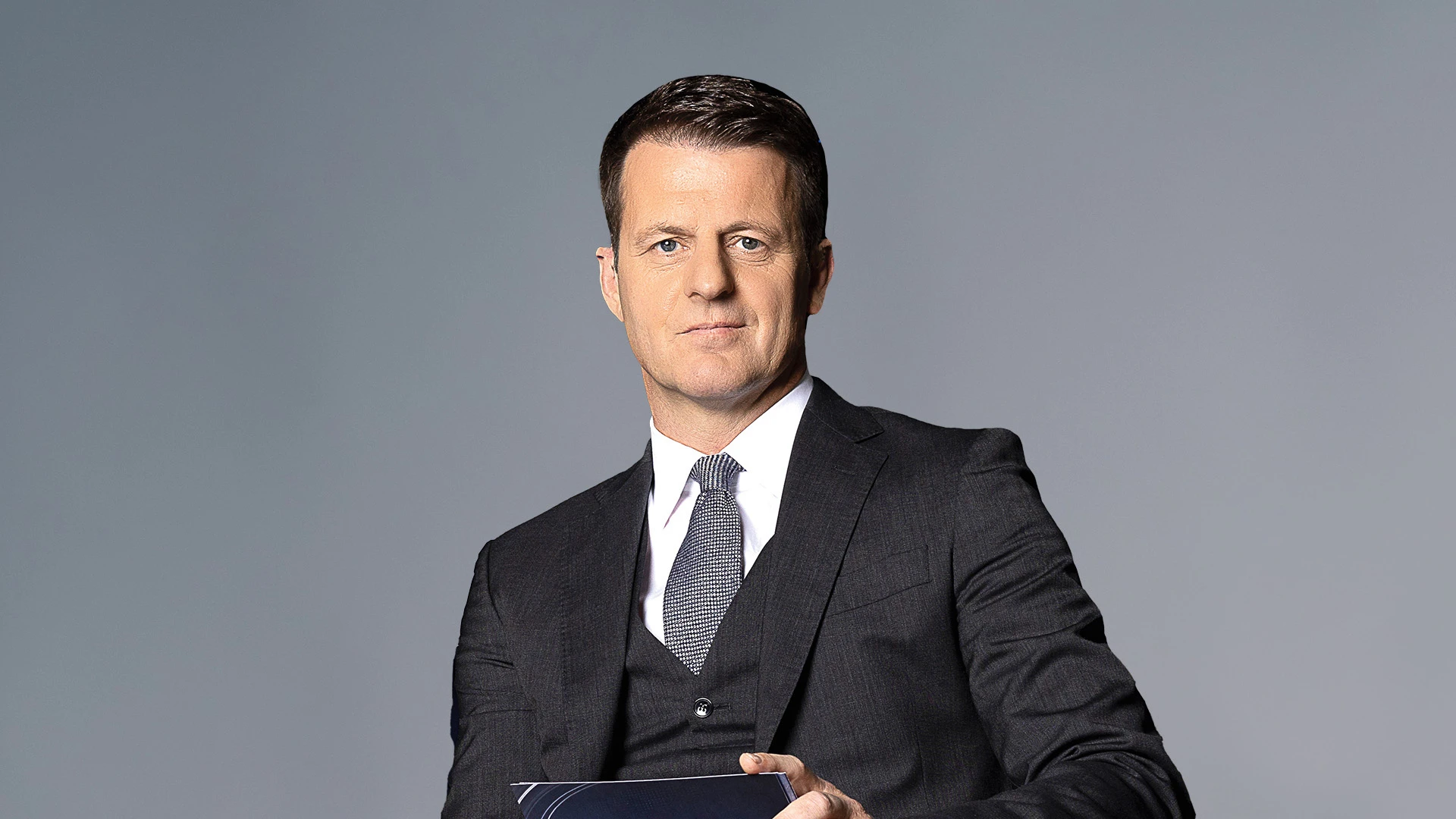Nach der Ermordung des US-Aktivisten Charlie Kirk grassiert wieder die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg. Tatsächlich sieht es so aus, als sei die Enthemmung, die immer größere Teile der Bevölkerung via Social Media erfasst, kaum noch aufzuhalten.
Schon seit der ersten Präsidentschaft von Donald Trump, spätestens aber seit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 beherrscht viele Beobachter der Entwicklungen in den Vereinigten Staaten eine ganz konkrete Sorge: dass die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft, die schon länger zu beobachten, aber durch Trumps enthemmte Rhetorik noch einmal entscheidend angefacht worden sei, irgendwann in gewaltsamen Zusammenstößen auf den Straßen der großen Städte des Landes münden würde. Ein neuer Bürgerkrieg steht im Raum, und man hat den Eindruck, dass die einschlägigen Prophezeiungen über das inzwischen handelsübliche Angstlust-Geplärre rechter und linker Empörungsakrobaten diesseits und jenseits des Atlantiks hinausgeht.
Gleichzeitig bereiten die europäischen Regierungen ihre Bevölkerungen politisch, ökonomisch und intellektuell auf einen Krieg gegen Russland vor. Hier wie dort wird den Menschen erklärt, dass es ums Ganze geht. Die Freiheit muss vor den Unterdrückern gerettet werden, die Demokratie vor den Autokraten, das Eigentum vor den Kommunisten, die Religion vor den Gottlosen, das kulturelle Erbe vor dem globalisierten Kulturkapitalismus. Gut gegen Böse, Licht gegen Finsternis.
Der Kampf zwischen ökonomischen Verlierern und verpeilten rich kids ist eine wirklich traurige Veranstaltung.
Entwurzelung als Wurzel
Falls sich jemand in die historisch-gesellschaftlichen Entwicklungen vertiefen will, die uns dorthin geführt haben, wo wir heute stehen (oder eigentlich eher liegen), sei ihm Hans Magnus Enzensbergers brillanter Essay „Aussichten auf den Bürgerkrieg“ empfohlen, der vor etwas mehr als 30 Jahren erschienen ist und an Aktualität nicht nur nichts eingebüßt hat, sondern sogar so wirkt, als hätte Enzensberger schon lange vor deren Aufkommen detailliert über die Funktionsweise der sozialen Medien als Hauptbeschleuniger des Weltenbrandes Bescheid gewusst.
Entscheidend für das Verständnis der beschleunigten Polarisierung und der rhetorischen Radikalisierung an allen Enden des politischen und gesellschaftlichen Spektrums ist: Wir haben es nicht mit einem Wiedererstarken politischer Ideologien mit konkreten Programmen und einer nachvollziehbaren Geschichte zu tun, die wieder mehr Anhänger und Gläubige finden, sondern mit einer Masse von vollkommen ideologie- und sinnbefreiten Individuen, die in einem relativ primitiven-Reiz-Reaktion-Schema entweder auf Ressentiments oder auf Angebote der Hypermoral reagieren. Sie werden durch die Möglichkeiten der digitalen Medientechnologie innerhalb kürzester Zeit zum virtuellen Mob, und zunehmend lässt sich dieser virtuelle Mob auch auf der Straße mobilisieren.
Wer je einen Neonazi-Mitmarschierer aus der Nähe beobachtet oder mehrere Videos der österreichischen Gaza-Aktivistin Marlene Engelhorn konsumiert hat, versteht sofort, dass der Antrieb hinter den neuen Formen der Polarisierung nicht eine Überfülle an Überzeugung und Energie ist, sondern eine absolute Leere und Traurigkeit, für die man, wenn man sich nicht zufällig auf der anderen Seite befindet, fast ausschließlich Mitleid aufbringen kann. Der Kampf zwischen ökonomischen Verlierern und verpeilten rich kids ist eine wirklich traurige Veranstaltung.
Kirk und die Angst
Aktuell werden die Ängste vor einem Bürgerkrieg durch die Ermordung von Charlie Kirk befeuert. Kirk, der bis zum Tag seiner Ermordung den meisten Europäern, die sich nicht auf amerikanische Politik spezialisiert haben, kein Begriff gewesen ist, wurde vor einer Woche auf einem College-Campus im Bundesstaat Utah erschossen. Debatten mit „liberalen“ Collegestudenten waren sein wichtigstes Live-Format, und auch politische Gegner attestierten Kirk, dem ein wesentlicher Anteil an Trumps Wahlerfolg bei jungen Menschen zugeschrieben wird, dass er genau die Form des politischen Aktivismus betrieben habe, um die es vor allem gehe: mit jedem zu reden, der dazu bereit ist, auch und vor allem mit Menschen, die andere Ansichten haben.
Dass Kirk in den meisten europäischen Diskussion als Rechtsextremer und als Rassist, da und dort auch als Faschist gelabelt wurde und wird, ist Teil des Problems. „Faschist“ ist zu einem Begriff geworden, der überhaupt nichts Spezifisches mehr aussagt, außer, dass es sich um jemanden handelt, dessen Ansichten man ablehnt oder verabscheut.
Fast völlig verschwunden ist eine Haltung, die mein leider viel zu früh verstorbener Freund Carlo Strenger „zivilisierte Verachtung“ genannt hat. Strenger hatte vor allem die Tendenz im Blick, antidemokratische und illiberale Haltungen etwa in muslimischen Zuwanderer-Communitys zu ignorieren, um nicht als Rassist zu gelten. Das Prinzip gilt aber in jeder Situation, in der es um einen Wertekonflikt geht: Man kann und soll Haltungen, Überzeugungen und Programme verachten, aber nicht die Menschen, die sie vertreten. Die Häme, mit der in den sozialen Medien auf die Ermordung von Charlie Kirk reagiert wurde, war erschütternd, und man versteht jeden, der die Befürchtung hat, dass diese Form der Enthemmung irgendwann in gewalttätige Auseinandersetzungen münden wird.
Ich fürchte auch, dass der Zug Richtung Bürgerkrieg bereits abgefahren ist. Die Social-Media-Zahnpasta wird nicht in die Tube zurückkehren, bis das letzte Stück Vernunft und Zurückhaltung aus unserer Gesellschaft herausgedrückt ist.
Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: redaktion@news.at
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 38/2025 erschienen.