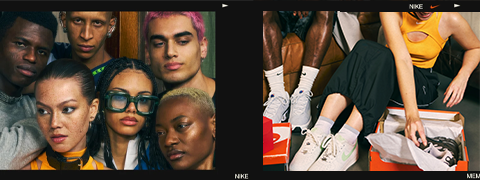Zum Interview erscheint er im geläufigen Zustand des Gesamtkunstwerks: in feinem Kaschmir mit seidenem Paisley-Stecktuch, das Haar aufs Feinste coiffiert, diszipliniert und wohlgelaunt. Dann beginnt er sein Leben zu erzählen, und das führte nicht lang nach seinem Beginn in die Hölle von Aussiedlung, Lager, Flucht und Ankommen in der nächsten Hölle. Die Serafins waren in Kybarti, Litauen, ansässig. Der italienischstämmige Vater, Offizier und Silbermedaillengewinner im Pistolenschießen bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, verdankte es den Salzburger Wurzeln seiner Ehefrau, dass er nach dem sowjetischen Einmarsch anno 1939 nicht zum Tod, bestimmt wurde. Ich war acht Jahre und meine Schwester ein Jahr alt, da wurden wir als Deutsche von den Russen weggeschickt. Es war kurz nach Weihnachten. Im Zug wurden wir von Soldaten mit Hakenkreuzfahnen und Schokolade empfangen. Damals hörte ich zum ersten Mal ,Heil Hitler. Dann wurden wir durch achtzehn Lager geschoben, bis in Memel eine Wohnung frei war. Mein Vater wurde sofort zur Wehrmacht eingezogen. Wir haben ihn den ganzen Krieg über nicht gesehen. Wir waren froh, dass er weg war, denn er war ein harter Mann und hat uns geschlagen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass die Front Memel erreichte. Hunderttausende wurden von den Nazis per Schiff evakuiert. In Berlin schlug die Familie ein Zelt im U-Bahn-Schacht auf. Dann begann der Fußmarsch ins Bayrische, nach Hof, wo Verwandte der Mutter lebten. Es war wie im Film, das Wagerl mit der Omi und der kleinen Schwester, durch Kälte, Tod und Hunger. Die Angst war dauernd da. Aber Angst ist gut. Sie wird zum Begleiter und Aufpasser. Und sie macht stark. Trotzdem, sagt er, wachte er in der Nacht noch schreiend auf, als der Krieg schon vorbei war und die Familie in Bayern ein Textilgeschäft aufbaute.
Triumph und Katastrophe
Wo immer fortan ein Eisenstein gesucht wurde, und sei es erkrankungshalber, verlangte der Fledermaus-Monopolist Schenk nach Serafin. So sang er in München siebenmal unter Carlos Kleiber, dem alle verängstigenden Genie. Wenig später setzte ihm Schenk den zweiten Lebensakzent, indem er ihn für Lehárs Lustige Witwe nach Frankfurt engagierte. Anja Silja, eine der größten Wagner-Sopranistinnen der Geschichte, war die Partnerin, und bald war er als Danilo fast ohne Konkurrenz. In Wien, im langjährigen Engagement an der Volksoper, war die ihm ehelich verbundene Operettendiva Mirjana Irosch die Glawari. Die gemeinsame Tochter Martina Serafin ist heute im dramatischen Sopranfach an die besten Häuser der Welt engagiert. Daniel, der Sohn aus der zweiten Ehe, beginnt eine Laufbahn als Operettentenor.
Ich hatte fast das Monopol
Sagt Serafin heute. Er absolvierte alle großen Fernsehshows, begab sich auf Tourneen um die halbe Welt und beutete sich aus. Ich habe Tag und Nacht gesungen. Nach der Vorstellung in der Volksoper fuhr ich mit dem Auto nach Zürich, wo ich 25 Abende im Jahr hatte. Ich bin ein Kriegskind und wollte die Flugtickets sparen. Die erste Stimmbandoperation vor dreißig Jahren war die Warnung, die er nicht beachtete. Zehn Jahre später trat an derselben Stelle wieder ein Knoten auf und wurde mittels Lasertechnik entfernt. Ich habe zum zweiten Mal viel zu früh weitergesungen. Und beim dritten Mal kam das Karzinom. Zufällig hat man das in der Histologie entdeckt. Sie haben mich sofort niedergespritzt und drei bis vier Millimeter entfernt, bevor die Metastasen kamen.
Religiös?
Ja, so würde er sich bezeichnen. Aber nicht in der Kirche. Dorthin gehe ich zu Weihnachten, weil ich an diesem Tag geboren wurde und dem Herrgott danke, dass ich der Welt geschenkt worden bin. Ich bin evangelisch, gehe aber lieber in die katholische Kirche. Da ist so ein Theater, und es riecht so gut. Als Investition in das Nachher will er das nicht verstanden wissen: Wenn es aus ist, sind wir wie ein Staubfetzen, der durch einen guten Wind verblasen wird. Meine Gene kann ich eventuell weitergeben. Und vielleicht da und dort ein Buch, lenkt er schwerelos, mit einem Augenzwinkern, von den letzten Dingen zum Marketing zurück. Und wenn wir das ominöse andere Wort schon verachten wollen: Fabelhaft ist der Mann in jedem Fall.
Heinz Sichrovsky / Susanne Zobl
Das ganze Interview lesen Sie jetzt im neuen NEWS 42/09