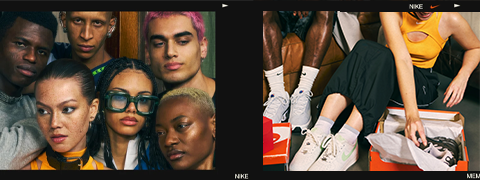Die Geschichte ist einfach und wird dennoch für rätselhafte gehalten: Ein Prinz findet eine Fremde im Wald, nimmt sie mit, gründet mit ihr eine Familie, verdächtigt Frau und Halbbruder einer Affäre und bringt aus Eifersucht den Halbbruder um. Die Frau stirbt. Maurice Maeterlinck aber hat mehr geschrieben als eine schnöde Eifersuchtsgeschichte.
Nahezu jeder und jede Figur und Szene, verweist oder bedeutet etwas, wie es eben so ist im Symbolismus. Debussys Vertonung macht alles noch schlimmer und bringt einen erotischen Thriller heraus. Das Gegenteil von allem ist in der Staatsoper der Fall. Marco Arturo Marelli zeigt ein naturalistisches Stück mit ganz natürlichen Protagonisten, die sich in einem düsteren Schloss nach Licht sehnen, ständig durch dunkles Wasser waten, als stünde die Staatsoper gerade unter Aqua alta.
Ob die ständige Planscherei die Entwicklung erotischer Spannungen wegwäscht, mag jeder sehen wie er will. In der Personenführung wird wenig dafür getan.
Pelléas ist hier eher wie der Absolvent eine "Reifeprüfung" angelegt, anstatt eines glaubwürdigen Liebhabers. Das liegt aber keineswegs an der Besetzung. Adrian Eröd erfüllt die Tenor-Partie des Pelléas mit seinem flexiblen Bariton glänzend. Wenn er singt, spürt man, dass da mehr ist als gezeigt werden darf. Unter dem Motto, nur schön keusch bleiben, zeigt Olga Bezmertna die Melisande wie die Abgängerin einer Hauswirtschaftsschule aus dem 19. Jahrhundert. Stimmlich fein nuanciert, bleibt es das einzige Rätsel dieser Aufführung die Eifersucht des Gemahls Goulod.
Eigentlich hätte man in dieser Produktion den Titel ändern müssen, denn im Zentrum steht hier Goulod. Und das liegt an Simon Keenlyside. Der Brite ist ein Singdarsteller, der über ein Höchstmaß an Dramatik verfügt. Stimmlich und darstellerisch sorgt er für atemberaubende Momente. Weitere Lichtblicke sind Franz Josef Selig (Arkel), Bernarda Fink (Genevieve) und Maria Nazarova (Yniold).
Alain Altinoglu packt forsch zu, setzt die Partitur klar und trocken um. Zuweilen hat man den Eindruck, er hält Dramatik für Lautstärke. Aber das täuscht. Es wäre einen Versuch Wert, die schwarzen Zwischenvorhänge, mit denen Marelli sinnfreierweise die Szenen trennt, einmal wegzulassen. Dass es bei der Premiere durch einen Vorhang zur Panne kam, war dann bei einer immer wieder in Mediokrität versinkenden Aufführung auch schon egal.