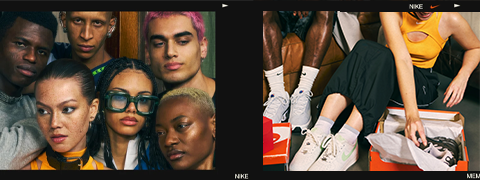Aus dem nahen Bayern meldet sich mit eiskalten Regentropfen und tückischen Rüttelattacken schon der amtlich erwartete Orkan. Aber der Herr am Holztisch unter dem ächzenden Kastanienast muss ausdampfen: erhitzt, echauffiert von einem tollen Theaterabend vor knallvollen Reihen mit kollektiver Standing Ovation. „Und die alte Dame auf dem Rollstuhlplatz!“, schwärmt der Schauspieler Ben Becker, während es über dem Salzburger Mirabellgarten unwirtlich wird. In der Tat war das eindrucksvoll: wie sich der Tyrann Caligula in seinem Eisbärenmantel inszenierungsgetreu in den Zuschauerraum stahl und nach langem, lauerndem Verweilen lostobte, worauf eine alte Dame vor Schreck laut aufschrie. Sie applaudierte nachher am frenetischsten.
Auf dem Hochseil
So mag es Ben Becker, der mit Albert Camus’ „Caligula“ am Salzburger Landestheater einen Kantersieg einfuhr: die Leute packen, dass es ihnen den Atem verschlägt; das Innere einer Rolle erkunden, wo es gefährlich wird. „Ich bin in der Ausübung des Berufs sehr existenziell“, sagt er, und das vom Leben gemeißelte Gesicht beglaubigt die Ansage. „Ich kann nicht anders. Ich kämpfe immer um mein Leben. Mein Papa sagte, den Mut, so wie ich über das Drahtseil zu gehen, hätte er nie gehabt. Ich möge aufpassen, dass ich nicht runterfalle.“
Und wurde die Warnung des bedeutenden Schauspielers Rolf Becker durch die Ereignisse beglaubigt? Ist der Sohn vom Seil gestürzt? „Ja, aber ich hab mich im letzten Moment gehalten und bin wieder draufgeklettert“, kommt er auf lang vergangene Lebensexzesse. „Ich bin privat manchmal sehr weit gegangen. Aber jetzt bin ich älter und will auch die Raucherei aufgeben“, sagt er und zieht an der Zigarette zum großen Stiegl hell. „Aber was den Beruf angeht: Da bin ich es dem Publikum schuldig, existenziell zu sein.“ Keiner könnte ihm das absprechen in der Rolle des Camus’schen Gewaltherrschers, der in konsequenter Außerkraftsetzung der Moral Freund und Feind vernichtet und sich damit die absolute Freiheit der Anarchie nimmt.
Er wäre nicht der Erste, der sich mit dieser Art Intensität im Leben und auf der Bühne einen Herzinfarkt eingehandelt hätte. „Ich kann mir Herzinfarkt gar nicht vorstellen“, sagt er. „Ich habe auch keine Lust dazu. Bei allem Hang zur Selbstzerstörung bin und bleibe ich ein Sonnenkind. Gott hat mich lieb. Ich mache es ihm nicht immer leicht, aber er ist auf meiner Seite. Er wiegt mich in den Schlaf. Mit ihm nuckle ich am Kopfkissen. Er ist mein Kumpel. Aber auf den Sack geht mir die weltliche Scheiße, was die hier treiben. Ich hasse diese momentane Zeit. Dieser wahnsinnige Rechtsruck. Dass kleine Kinder im Mittelmeer vom Schlauchboot fallen, und ich muss mir bei RTL2 die Geissens anschauen oder einen anderen Verblödungsscheiß.“ Deshalb mag er Figuren wie Caligula, der die Leute zwingt, mit der Bestie Mitleid zu empfinden und dabei ihre eigenen Abgründe zu entdecken. Er selbst habe einmal erwogen, Priester zu werden, kommt er auf den göttlichen Kumpel zurück.
Aus anderer Zeit
Mit seiner klassischen, suggestiven Bühnensprache scheint er wie aus der Zeit gefallen, in der postdramatische Hanswurste blödelnd durch Mikroports näseln. „Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich klassisch von der Pike auf gelernt habe. Ich mag das Wort Stolz nicht, aber ich bin froh, dass ich Menschen wie Gert Voss und Otto Sander zusehen durfte.“ Letztgenannter war sein heiß verehrter Stiefvater, ein Riese in der europäischen Theatergeschichte. Dem fragilen Mann wird der Stiefsohn, ein sensibles Kraftpaket auf der Bühne und im Leben, auf geheimnisvolle Weise immer ähnlicher. „Otto hat mich auf die Spur gebracht, wie man mit Sprache umgeht. Da bin ich auch ein konservativer Schauspieler, konträr zu dem dusseligen Ruf, der mir vorauseilt. Es bereitet Freude, dem Willen des Dichters auf der Spur zu sein. Da habe ich mir eine große Freiheit erarbeitet.“
Das grassierende Trendtheater mit Psychologieverbot? „Mag ich überhaupt nicht. Ich mache aus Caligula auch nicht meinen Freund Moshammer, den ich sehr geschätzt habe“, kommt er auf den gewaltsam zu Tode gekommenen Modeexzentriker. „Ich mache aus dieser Rolle keinen Adolf Eichmann, keinen Maaßen, von der AfD, FDP, CDU, CSU oder so. Ich gebe die Rolle nicht dem Theaterspielen anheim.“
Der Auftritt in Salzburg ist ein markanter, denn nach einem Jahrzehnt, in dessen Verlauf er zum Einzelkämpfer wurde, tritt er wieder in einem Theater mit dessen Ensemble auf. Gut, dass es Salzburg ist, wo er zwischen 2009 und 2012 dem Tod im „Jedermann“ sagenhafte Präsenz verschaffte. Keiner hat ihn hier vergessen. Kein Wunder, dass die Besucher losrannten, sowie der Kartenverkauf eröffnet war.
„Ich habe vier Jahre in der Salzburger Disney World den Tod gegeben. Ich habe eine Hassliebe zu der Stadt“, hält er glückliche Rückschau auf die Zeit, da er in exklusiver Lederhosenadjustierung die markanteste Gestalt des Sommers war, Pereiras parvenuhaften Festspielball durch treffende Zwischenrufe zu kippen drohte und tags darauf seine Lebensgefährtin ehelichte. „Ich habe in Salzburg vier Jahre lang viel Spaß verbreitet und die schönsten Sommer meines Lebens verbracht. Ich habe hier geheiratet, ich bin mit Frau Minichmayr nachts schwimmen gegangen und mit Herrn Ofczarek im Hubschrauber geflogen.“ Nun würde er gern den Judas auf dem Domplatz spielen, verweist er auf vorsichtige Anbahnungsgespräche.
Unternehmen Judas
Judas ist das Resultat eines Rückzugsprozesses aus dem Betrieb. „Ich habe irgendwann aufgehört, mitzumachen, ich habe provoziert, wurde frech.“ Warum? „Weil ich hinterfrage. Ich provoziere nicht um der Provokation willen, sondern um Fragen zu stellen. Nicht zerstören, verändern! Und irgendwann war ich Ben Becker und habe meinen eigenen Kram gemacht: erst Musik mit meiner Band und dann über die Musik zurück zur Literatur, Brecht, Ernst Jünger, Schiller, Thomas Bernhard, Celan.“ Es folgte eine stürmisch angenommene Solotournee zur Bibel, ehe er sich dem Jünger Judas zuwandte, der in die Hölle der Ächtung musste, um das Erlösungswerk des Gottessohns zu ermöglichen.
Da hatte Becker schon sein eigenes Team um sich formiert: Techniker, Ton, Beleuchtung, persönliche Assistenz, Management. Dazu kamen der Dramaturg und Autor John von Düffel und die Regisseurin Marike Moiteaux, die nun auch für den Salzburger „Caligula“ verantwortlich zeichnen. Sie kontrolliert, wenn ihn auf der Bühne der Überschwang packen will. Nichts, sagt er, wäre peinlicher, als wie eine Lokomotive durch die Wände zu brechen. „Diese Art Arbeit hat mir mehr Freude bereitet, als im Fernsehen Blödsinn zu spielen. Es gibt dort immer wieder ganz schöne Sachen, und ich sage auch nicht Nein, und ich versuche auch einen ,Polizeiruf‘ so zu spielen, dass ich emotional berühre. Schließlich habe ich Familie und meine Tochter hält ein Pferd.“ Eine Serie auf Netflix oder Sky, das wäre schon etwas, und um das, was David Schalko für den ORF herstellt, beneidet er Österreich und alle, die daran mitwirken können.
Das Theater aber hält ihn genetisch umfangen, und er macht sich bereit, den ihm richtig erscheinenden Weg auch als Regisseur zu beschreiten. „Ich mag kalkuliertes Zeugs nicht. Einen Woyzeck kalkulieren, das geht nicht. Deshalb bin ich kurz davor, selbst zu inszenieren und zu produzieren. Otto Sander hat mir einen Satz hinterlassen: ,Du bist kein Schauspieler, du bist ein Macher.‘ Da war ich erst sauer, aber heute weiß ich, dass ich gerne umsetze, auch an einem kleinen Theater, warum nicht? Ich bin schon als Kind mit Puppen zu Hause gesessen und habe mir kleine Theater gebaut. Das tue ich bis heute. Wenn du zu mir nach Hause kommst, steht oben auf dem Schrank ein fertiges Bühnenbild für Kafkas ,Bericht für eine Akademie‘.“ Den akademischen Affen würde er selbst spielen und den Abend „Ape“ nennen.
Jetzt ans Volkstheater!
Von den großen Bühnen, dem Burgtheater zum Beispiel, hört er nichts. „Es gibt einige, die Angst vor mir haben, aber das macht nichts.“ Aber einer hat angerufen, der ihn gern nach Wien holen würde: Paulus Manker nämlich („wir haben uns heimlich lieb“). Womit das Gespräch beim ernsthaft gefährdeten Wiener Volkstheater ist. Jederzeit, sagt er auf Anfrage, würde er dort inszenieren und spielen. „Ich mache den Laden rappelvoll. Wir füllen gerade ein Theater mit sonst nicht überragender Auslastung bis auf den letzten Platz. Wir zeigen, wie man Leute abholt, wenn man ihnen gute Geschichten erzählt.“
Und die Direktion, die im Jänner ausgeschrieben wird? „Ja“, sagt er ohne Umstände. „Mit den besten Schauspielern, derer ich habhaft werden kann. Eine eigene Märklin-Eisenbahn, so wie die im Keller meiner Kindheit, nur größer, das ist ein Traum. So wie jetzt in Salzburg, wo wir zu dritt diese Produktion gemacht haben.“
Aber das neue Theater der Wohlerzogenheit, das 60 erwachsene Burgtheatermitglieder dazu anstiftet, den vor vier Jahren aus dem Amt geschiedenen Direktor Matthias Hartmann mit einem offenen Brief zu drangsalieren, weil er vor fünf Jahren auf der Probe einen unkorrekten Witz erzählt hat? Becker weist Sympathien von sich. „Wenn sich Hartmann noch vor Antritt 500.000 im Koffer rüberschieben lässt, ist etwas Unverschämtheit im Spiel, und mein Mitleid über einen offenen Brief hält sich in Grenzen.“
Eine Theaterfamilie würde ihm vorschweben, aber ohne Mitbestimmungsromantik, wie sie Peter Stein einst mit Otto Sander und anderen in Berlin probierte. „Jetzt presst er Oliven in der Toskana und kommt nicht einmal zur Beerdigung von Peter Fitz oder Otto Sander, was aber nichts machte, weil ohnehin über 3.000 Leute da waren.“
„Lass sie leben!“
Und #Metoo mit dem Auslöschen ganzer Lebenswerke? Kevin Spacey, selbst Woody Allen? „Das Leben hat mehr als zwei Seiten. Es ist so einfach, für immer zu verurteilen und jemanden auszuradieren. Das ist auch langweilig. Spannender ist, sich auseinanderzusetzen, den Versuch des Verstehens zu unternehmen. Lass sie leben! Menschen verletzten ist scheiße, und man muss ein deutliches Stopp sagen. Aber Menschen aburteilen und exekutieren, da bin ich skeptisch. Wenn Herr Weinstein seine Besetzungscouch ausnützt, kann ich nur sagen: Er ist nicht der Einzige. Das wird in der Bank nicht anders sein.“
Noch etwas? Ja, eine Geschichte, die ihm plötzlich die Tränen in die Augen schießen lässt, weil sie – wen sonst – die Tochter Lilith betrifft. Am Tag der „Caligula“-Premiere wurde sie 18 und vertraute ihm an, dass es wehtäte, wenn er da auswärts wäre. Also flog er nach der samstäglichen Generalprobe nach Berlin und buchte für den folgenden Premierentag den Rückflug, den er im Stau versäumte. Ein Ticket nach München war verfügbar, doch die Taxifahrt nach Salzburg führte in einen weiteren Stau, der die Premiere an den Rand des Kippens brachte. 15 Minuten vor Beginn rannte er den desperaten Intendanten nieder: „Gangway, alle weg! Cola, Espresso, Williamsbirne, umziehen, raus auf die Bühne.“ Der Parcours des Wahnsinns endete im Triumph.
Die Tochter, sagt er, während der Sturm deutlichere Signale der Dominanz setzt, will nach London, um sich Gott sei Dank beim Film oder beim Theater umzusehen, statt weiterhin Tierärztin werden zu wollen. „Ich bin kein Naturpapa, der jeden Sonntag mit ihr in den Wald wandern geht. Aber das macht nichts. Väter-Töchter-Beziehungen sind etwas sehr Eigenes. Wir haben uns unheimlich lieb, und die Dame ist mir eigentlich das Wichtigste, was es auf der Welt gibt. Wichtiger als alles.“ Womit nun wirklich das Nötige gesagt ist.
Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Printausgabe 39 2018