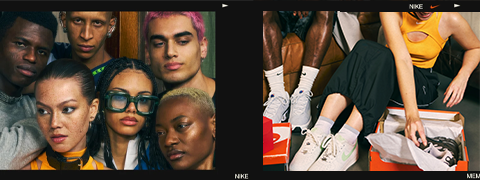Ihre Autobiographie umfasst über 3.000 Seiten. Sie beschreiben Details aus Ihren Ehen, von Ihrer Familie, von Ihren Freunden. Hatten Sie niemals Skrupel, Menschen, die Ihnen nahe stehen wie einer Reality-Show à la „Big Brother“ auszustellen?
An so etwas hatte ich nicht eine Sekunde gedacht. Das kann man nicht vergleichen. Das ist ein großer Unterschied. Denn „Big Brother“ war gemacht, das war eine Konstruktion. Aber das ist das alles nicht. Meine Geschichten gibt es wirklich. Aber mein Projekt wurde am Anfang sogar mit Facebook verglichen. Aber auch das ist es nicht. Denn bei Facebook geht es nur um Selbstpräsentation. Natürlich ist mein Projekt irgendwie Teil dieser Kultur, aber es ist eine Art Alternative. Meine Bücher sind zwar auch Selbstpräsentation, aber sie erzählen vom Backstage-Bereich, von Dingen, die man normalerweise nicht preisgibt.
Gibt es Szenen, die Sie lieber nicht geschrieben hätten?
Nein. Aber ich denke schon während des Schreibens darüber nach, dass manches beschämend ist, was ich über mich schreibe. Aber Schreiben ist für mich Freiheit, und die existiert nicht, wenn ich nicht schreibe.
In Ihrer Autobiographie erzählen Sie von Ihren argen Alkoholexzessen. Bewahrt Sie das Schreiben davor, noch mehr zu trinken?
Irgendwie schon. Denn schreiben ist wie Saufen, man gerät in einen Rausch, man spürt sich selbst nicht mehr. Ich trinke noch ab und zu. Aber der Rausch beim Schreiben ist besser.
Erfinden Sie auch manchmal etwas, um Ihre Geschichte aufregender zu machen? Im Buch beschreiben Sie, wie Sie mit einem Glasscherben Ihre Wange aufritzen. Wo ist die Narbe?
Das ist nicht erfunden. Ich hatte Glück, es ist keine Narbe geblieben.
War das ein Akt der Selbstbestrafung? Etwa dafür, dass Sie Ihrem Bruder einmal mit einem Weinglas das Gesicht verletzt haben?
Die Attacke auf meinen Bruder war das einzige Mal, dass ich gegen einen Menschen aggressiv wurde.
Wie ist das für Sie, wenn Sie vor einem großen Publikum auftreten? Ist es nicht beunruhigend, dass jeder fast alles von Ihnen weiß?
Nein, an so etwas denke ich nicht bei Lesungen.
Im Zentrum Ihrer Bücher steht die schwierige Beziehung zu Ihrem Vater. Sehen Sie Ihren Vater heute anders?
Ich denke viel darüber nach. Es mag seltsam klingen, aber ich fühlte mich immer als Sohn, bis ich vierzig wurde. Erst dann begann ich mich als eigene Person zu sehen, erst dann fühlte ich mich unabhängig. Ich habe erkannt, dass meine schwierige Kindheit ein Teil von mir ist. Und ich möchte niemand anderer sein. Ich sehe meinen Vater heute auch anders. Jetzt habe ich selbst vier Kinder. Wie alle Eltern möchte ich, dass sie glücklich sind und eine harmonische Kindheit haben.
Könnten Sie sich überhaupt ein Leben ohne zu schreiben vorstellen?
Nein, das kann ich nicht. Ich sehe Sinn meines Lebens darin, über mein Leben zu schreiben. Würde ich etwas Anderes machen, würde ich einen Film drehen oder ein Bild malen. Es müsste immer etwas Kreatives sein.
Wie schaffen Sie es, alle Ihre Erinnerungen abzurufen?
Das ist wie ein Film. Das ist ein Prozess. Wenn ich ein Buch beginne, dann weiß ich nicht, in welche Richtung es geht. Die Erinnerungen sind immer da. Man muss sie nur abrufen. Bei „Träumen“ stand die Erinnerung an meine Reise nach Europa am Beginn.
Wie organisieren Sie diese Erinnerungen?
Überhaupt nicht. Das ist Improvisation von Anfang bis zum Ende. Man erinnert sich an das Eine, dann an das Andere.
Wann haben Sie Ihren Erfolg wirklich realisiert?
Als die Journalisten schockiert reagierten, weil ich über die Realität geschrieben habe, dachte ich mir, da muss etwas an meinen Büchern dran sein. Sie hatten eine Wirkung. Und das fand ich gut.
Haben Sie manchmal Angst, dass Ihr Erfolg plötzlich enden könnte?
Die habe ich. Und ich weiß, dass er einmal vorbei sein wird. Ich bereite mich darauf vor, dass der Erfolg nur eine kurze Zeit währt. Aber während des Schreibens darf ich nicht daran denken, auch nicht an die Leser. Da geht es nur um das Wesentliche, das Schreiben. Da muss ich alles geben.
In Skandinavien sind bereits alle sechs Bände ihrer Autobiographie erschienen. Arbeiten Sie schon an einem neuen Projekt?
In Norwegen erscheinen nächstes Jahr vier schmale Bücher von nur 250 Seiten. Das sind Texte über verschiedene Gegenstände des Alltags. Das sind keine Erzählungen, nur Beschreibungen, also das Gegenteil meiner vorigen Bücher.
Wie kam es dazu, dass Sie Ihre Autobiographie „Min kamp“ („Mein Kampf“) nennen?
Das war Zufall. Als ich am ersten Buch geschrieben habe, sprach ich mit einem Freund über meinem Kampf beim Schreiben. Er meinte, das sei der Titel für mein Buch. Und so war es. Aber im Grunde meine ich das ironisch. Ich wusste, dass ich damit viele ärgern würde. Das ist ja ein sehr unangenehmer Titel, aber ich will ja nicht angenehm sein.
Hatten Sie keine Angst, dass man Sie für einen Rechten hält?
Doch, aber ich bin alles andere als rechts.
Weshalb leben Sie eigentlich in Schweden?
Ich liebe Schweden.
Aber Sie üben oft heftige Kritik an Ihrer Wahlheimat.
Schweden ist ein sehr problematisches Land. Die Kultur der Mittelklasse dominiert alles. Es herrscht politische Korrektheit. Das mag wie ein Klischee klingen, aber es gibt in Schweden keine wirklichen Diskussionen. Wenn man eine andere Meinung hat als die öffentliche, ist man sofort der Böse. Das größte Problem in Schweden ist Immigration. Die Anti-Immigrationspartei ist die stärkste.
Ist Norwegen aufgeschlossener?
Absolut. Man kann dort alles sagen.
Wie kommt das? Norwegen und Schweden müssten doch eine ähnliche Kultur haben?
Norwegen hatte nie eine Oberschicht. Und es war lange unter dänischer Herrschaft. Norwegen aber lässt sich von niemandem etwas aufzwingen. Deshalb sind wir auch nicht bei der EU.
Fühlen Sie sich durch Verrisse verletzt?
Ich wusste, dass sie kommen werden. Wenn man schreibt, tut man sein bestes. Aber von einer schlechten Kritik kann man nie etwas lernen.
Von wem kann man etwas lernen?
Möglicherweise von einem Lektor. Ich war selber auch Kritiker.
Ihr Buch „Träumen“ endet mit Ihnen als Leser eines Kriminalromans Ihres schottischen Kollegen Ian Rankin. Lesen Sie Krimis?
Rankins Kriminalromane mag ich sehr. Und als Jugendlicher habe ich viele Krimis und Thriller gelesen, die von John Le Carre mochte ich sehr. Denn alles, was man über das Geschichtenerzählen lernen kann, stammt aus diesen Büchern.
Verhalten sich manche Menschen in Ihrer Umgebung anders, seit Sie Ihre Bücher veröffentlicht haben. Es muss doch jeder fürchten, dass er in einem Ihrer Bücher einmal vorkommt?
Manche benehmen sich schon etwas anders, aber nicht, weil sie fürchten, dass ich über sie schreibe, sondern weil ich so erfolgreich bin.
Wird es eine Fortsetzung Ihrer Autobiographie geben?
Es tut gut, über eine Fortsetzung nachzudenken. Dieses Projekt habe ich geschrieben, als ich noch ein normales führte. Das ist jetzt anders.
Stimmt es, dass Sie schon um halb fünf in der Früh aufstehen, um zu schreiben?
Das stimmt. Ich gehe früh ins Bett. Denn ich habe vier Kinder, und wenn ich vor ihnen aufstehe, dann habe ich noch ein paar Stunden für mich.
Wie denken Sie als Vater darüber, dass man Fotos von toten Flüchtlingskindern in Zeitungen abdruckt? Im ersten Teil Ihrer Autobiographie schreiben Sie, dass man Tote zeigen soll.
Jeder könnte so das Leid verstehen. Aber das ist auch problematisch. Wenn sich die Leute an diese Bilder gewöhnen, wäre das schrecklich. Es würde sie dann nicht mehr berühren.
Wer wird Ihrer Meinung nach den Literatur-Nobelpreis bekommen? Oder machen Sie sich schon Hoffnungen?
Ich doch nicht. Aber ich wette jedes Jahr beim Nobelpreis. Einmal setzte ich auf Alice Munroe. Ein Jahr danach bekam sie ihn. Ich finde, Thomas Pynchon sollte ihn bekommen. Das wäre endlich wieder einmal ein amerikanischer Autor. Wenn sich die Akademie dazu durchringt, hätte sie 15 Jahre Ruhe vor den Amerikanern, dann könnte ihnen niemand vorwerfen, dass sie die Literatur der USA ignorieren.