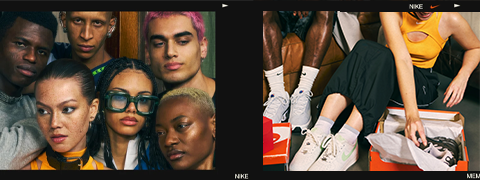Mister Rankin, gibt es Regeln für einen guten Kriminalroman?
Kriminalliteratur verfügt über ein breites Spektrum. Viele Leser betrachten Kriminalromane wie Rätselaufgaben - sie wollen herausfinden, wer der Täter ist. Wenn sie es nicht schaffen, löst der Ermittler für sie das Problem. Und die Welt ist wieder in Ordnung. Das wichtigste für jeden Krimi ist aber ein starker, charismatischer Ermittler.
So wie Ihr Inspector John Rebus, der bereits dreißig Jahre für sie ermittelt. Weshalb ist auch er, wie die meisten seiner literarischen Kollegen, ein Außenseiter mit Hang zu Hochprozentigem.
Meinen ersten Rebus-Roman habe ich 1986 geschrieben. In der Gasse in Edinburgh, in der ich damals wohnte, gab es eine Bar, in der fast nur Polizisten verkehrten. Die meisten waren geschieden und tranken tatsächlich Whiskey. Ich habe das gut verstanden. Irgendwie müssen sie ihren Job doch verarbeiten. Denn zu Hause wollen sie schon gar nicht von den schrecklichen Dingen erzählen, die sie erlebt haben. Daher scheitern auch die meisten Ehen von Polizisten.
Bilden Sie in Ihren Romanen demnach genau die Realität ab?
Meine Romane sind eher eine Mischung aus Fiktion und Wirklichkeit. Ein Außenseiter wie Rebus wäre in der Realität des heutigen Polizeiapparats undenkbar. Kein Detective dürfte heute so agieren wie Rebus und Ermittlungen auf eigene Faust durchführen. Aber genau das mögen die Leser. Rebus arbeitet so, wie man in den Siebziger- und auch noch in den Neunzigerjahren ermittelt hat. Der Polizeichef von Edinburgh hat mir vor ein paar Jahren einmal gesagt, dass er gern so einen Ermittler wie Rebus im Team gehabt hätte.
Recherchieren Sie direkt bei der schottischen Polizei?
Ich gehe nur zur Polizei, wenn ich spezielle Fragen habe oder wenn ich zu bestimmten Anlässen eingeladen werde. Und das ist ganz nützlich, denn es gab Veränderungen bei unsrer Polizei, und die sollte man als Autor von Kriminalromanen kennen. Früher hatten wir acht regionale Polizeistationen, jetzt gibt es nur noch eine in Sterling zwischen Glasgow und Edinburgh. Auch die Methode, wie man nach Mördern fahndet, hat sich verändert. Anstatt sich auf die regionalen Kräfte zu verlassen, holt man Teams von Spezialisten. Die Rolle des regionalen Polizisten ist reduziert. Und das sorgt für enormen Ärger. Wenn das fremde Team kommt, muss es zuerst die Stadt kennenlernen und dabei geht viel wertvolle Zeit bei den Ermittlungen verloren.
Sie machen es Ihren Lesern oft sehr einfach. Oft geben Sie bereits auf den ersten zwanzig Seiten sehr deutliche Hinweise auf den Täter. Verringert das nicht die Spannung?
Ich habe kein Problem damit, wenn jemand bereits auf Seite zehn, weiß, wer der Mörder ist, wenn er den Roman trotzdem zu Ende liest. Die Lösung des Falles ist für mich das Uninteressanteste. Denn ich will das Bild einer Gesellschaft zeigen, in der gewisse Verbrechen möglich sind. Mich interessiert vor allem, was Verbrechen über unsere Kultur verraten. Die Bluttat ist für mich wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, der nach und nach immer größere Kreise zieht.
Das ist auch in John Rebus 20. Fall, „Das Gesetz des Sterbens“ so. Ein pensionierter Staatsanwalt wird ermordet. Das Motiv des Täters, würde für viele Leser das Verbrechen rechtfertigen. Gibt es den gerechten Mord?
Das ist eine jener großen, moralischen Fragen, die ein guter Kriminalroman stellen soll. Weshalb fügen wir einander Böses zu? Und das soll sich auch der Leser selbst fragen. Krimis sollen belehren, aber ohne, dass man es merkt.
Und was sollte ein Krimi noch leisten?
Ein guter Kriminalroman kann auch helfen, unbekannte Orte zu entdecken. Wenn ich in ein Land fahre, in dem ich noch nicht war, lese ich dessen Kriminalliteratur. Die verrät viel über das viel über ein Land und dessen Bewohner. Und ein besonderer Vorzug ist auch, dass manche Krimis auch als Reiseführer dienen: Man erfährt, welche Stadtteile gefährlich sind, welche nicht.
Wie viele Morde muss es in einem guten Krimi geben?
Keinen einzigen. Über Morde schreibt man doch nur, weil sie absolute Verbrechen sind. Einen Mord kann man nicht rückgängig machen. Trotzdem muss nicht immer gemordet werden.
Oft attestiert man Kriminalschriftsteller einen Hang zum Töten. Könnten Sie sich vorstellen, jemanden zu ermorden?
Ja, sicher, aber es kommt auf die Umstände an. Würde jemand in mein Haus einbrechen und meiner Frau ein Messer an die Kehle halten, würde ich nicht zögern abzudrücken, wenn ich ein Gewehr zu Hause hätte. Aber ich besitze keine Waffen. Im Grunde genommen sind wir doch alle ganz nette Menschen, aber es fehlt nicht viel und wir können zu Killern werden. Ich war total schockiert, als ich in Amerika in einer Buchhandlung einen meiner Romane vorgestellt habe. Nach der Lesung hat mich ein freundlicher Zuhörer gefragt, ob ich seine Waffe auszuprobieren will. Ich habe das natürlich abgelehnt.
Haben Sie auch persönliche Erfahrungen mit Verbrechen?
In mein Haus wurde in den letzten zehn Jahren zweimal eingebrochen. Einmal waren wir sogar zu Hause, aber die Unholde blieben im Erdgeschoß. Viel mitgenommen haben sie auch nicht.
Wo ziehen Sie beim Schreiben die Grenze zur Brutalität?
In meinen Romanen kommt der Ermittler erst, nachdem das Verbrechen verübt worden ist. Wie brutal das war, kann ich also der Fantasie meiner Leser überlassen.
Gibt es für Sie Tabus in Kriminalromanen?
Man darf keine Hunde und Katzen töten. Ich habe selbst zwei Katzen. Aber in einem Roman musste ich eine Katze bei einem Unfall sterben lassen. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Leser sich darüber beschwert haben! Wenn Menschen ermordet werden, regt sich niemand auf, aber wenn Tiere in einem Krimi umkommen, ist die Empörung groß. Ist das nicht seltsam?
John Rebus ermittelt seinen 20. Fall als Pensionist. Wie viele Fälle planen Sie für ihn noch?
Ich mache keine Pläne. Rebus hatte ich ursprünglich nur für ein Buch vorgesehen. Als ich den ersten Rebus-Roman geschrieben habe, habe ich noch an der Universität von Edinburgh Literatur studiert. Für mich war es daher naheliegend, auf eine schottische Literaturtradition zurückzugreifen: jene von Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Wie Robert Louis Stevenson wollte ich jemanden schaffen, der die Fähigkeiten hat, Gutes und Böses zu tun. Im ersten Buch wird Rebus auch für den Killer gehalten. Ich könnte es nicht fassen, dass man meinen ersten Roman in die Kategorie Kriminallitertur einordnete. Denn ich hatte zuvor keine Krimis gelesen. Jetzt begleitet mich Rebus schon dreißig Jahre lang. Er ist Mitte Sechzig und in Pension, aber nicht zu alt, um Fälle zu lösen.
Was aber, wenn Sie in zehn Jahren so alt sind wie ihr Kommissar, werden Sie dann noch Fälle für ihn schreiben?
Ich könnte mir vorstellen, dass ich einmal keine Bücher mehr herausbringe, aber ein Leben ohne Schreiben ist für mich nicht möglich.