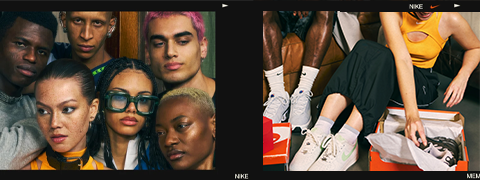Ein rühriger Fan Ihres ehemaligen Klubs Altach postete zu Ihrem Abschied: "Er weiß, wohin er will, weil er nicht vergessen hat, woher er kommt." Also, Herr Canadi, woher kommen Sie?
Aus einer Wiener Zuwandererfamilie, die im Jahr 1967, drei Jahre vor meiner Geburt, aus dem damaligen Jugoslawien hierhergekommen ist. Meine Eltern, mein um sechs Jahre älterer Bruder und ich lebten in Kaisermühlen zu viert auf 55 Quadratmetern mit Klo und ausschließlich kaltem Wasser am Gang - ich denke, ich weiß die Annehmlichkeiten, die ich heute genieße, schon richtig einzuschätzen. Mein Vater hat 35 Jahre als Stahlbauschlosser bei Waagner-Biro gearbeitet, meine Mutter beim Pharmaunternehmen Immuno. Sie haben versucht, uns möglichst viel Liebe zu geben, doch sie haben fast täglich von sechs in der Früh bis 16 Uhr im Akkord gehackelt, ihr Leben bestand fast ausschließlich aus Arbeit - da waren wir Kinder von Anfang an oft auf uns allein gestellt.
Wie war das damals als Gastarbeiterkind im 22. Hieb?
In der Früh sind wir halt in die Schule gegangen, doch die Aufgaben haben uns dann nicht mehr so sehr interessiert, die haben wir uns dann oft von den Mädels machen lassen. Nach der Schule sind wir lieber in den Kirchenpark oder auf die Wiese im oberen Bereich der Schüttaustraße, dem sogenannten "Strassl", kicken gegangen. Der Otto, damals der Friseur im Grätzel, hat jeden Samstag ein kleines Kickerl organisiert und uns dann zu Cola und Wurstsemmeln eingeladen. Er war eine echte Legende, die sich um die Burschen von der Straße gekümmert hat.
Und Zuwandererkinder wie Sie, die waren damals die "Jugos"?
Ich bin schon das eine oder andere Mal so genannt worden, keine Frage, das war damals halt so. Ich muss so zehn, elf gewesen sein, als ich im Kirchenpark als "Tschusch" beschimpft worden bin. Ich bin sofort nach Hause gegangen, wild, verärgert. Ich wollte dann gleich wieder zurück, um das auf rustikale Art und Weise zu klären, doch meine Mutter hat gesagt: "Hör auf damit, das hat doch keinen Sinn."
Als Ihre Bundesligapremiere als Rapid-Trainer am vergangenen Sonntag gegen Red Bull Salzburg mit 1:2 verloren ging, war Ihre erste Kampfansage: "Die Legionäre müssen um 20 Prozent mehr leisten als die österreichischen Spieler, sonst spielen sie nicht." Nun haben Sie selbst Migrationshintergrund ...
Also, das muss ich entschärfen: Das war keine Kampfansage, ich wollte mich da auch nie auf eine Prozentzahl festlegen, sondern nur wachrütteln. Wir haben eigene Talente und eigene Nachwuchsakademien, und ich kenne das allgemeine Gesudere, wir würden unsere Talente zu wenig fördern. Daher sage ich: Wenn ich mir einen Spieler aus dem Ausland hole, dann muss er stärker als das österreichische Talent sein, den österreichischen Legionären im Ausland schenkt ja auch keiner etwas. Mich ärgert es, wenn ich höre, in der österreichischen Liga kann man als Legionär ganz locker mitspielen. Ich finde, es muss auch hier schwierig sein, sich durchzusetzen.
Was ist, neben dem Talent, die wichtigste Eigenschaft, die man als Profifußballer mitbringen muss?
Demut. Und glauben Sie mir: Der Fußballer Damir Canadi war als junger Kicker nicht demütig. Nein, ich habe als Junger bei Weitem nicht alles richtig gemacht. Wenn man materiell kaum etwas gehabt hat, dann in die Fußballwelt eintaucht und in sehr jungen Jahren rasch mehr verdient als die eigenen Eltern, dann geht man damit nicht immer richtig um. Nachdem ich meine Fußballerkarriere abgeschlossen hatte und ins Berufsleben wechselte, merkte ich, dass mir die Welt nicht alleine gehört und es nicht nur mich gibt, sondern dass ich mich anders verhalten, mich verändern muss.
Inwiefern verändern?
Wenn es nicht so läuft, darf man die Schuld nicht immer bei den anderen suchen. Als ich jung war, waren immer alle anderen schuld, einmal war es der Schiedsrichter, dann wieder der Trainer. Erst später habe ich systematisch versucht, mich selbst zu verbessern.
Worin unterscheidet sich denn das echte Leben vom Mikrokosmos Fußball?
Ich lernte beide Seiten kennen, und das sehr intensiv. Vor allem während meiner ersten Station als Profibetreuer, da war ich Co-Trainer bei Lokomotive Moskau. Man muss sich das einmal vorstellen: Unmittelbar vor meinem Engagement in Russland war ich noch Regionalligatrainer beim FAC und arbeitete hauptberuflich als Hausbesorger - und dann befand ich mich plötzlich inmitten dieser Millionärswelt: Da gab es Spieler, die irgendwo zwischen 1,5 und drei Millionen Euro pro Saison verdienten und mit dem Porsche zum Training vorgefahren sind. In dieser Welt geht man schon einmal zu viert um 6000 Euro abendessen - das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich bin dann auch nicht in die Moskauer Restaurants mitgegangen, weil das so gar nicht meinem Wertesystem entsprochen hat. Ich hatte zuvor ja auch das andere Extrem kennengelernt.
Wann war das?
Das war so zwischen 25 und 30, da habe ich als Spieler einige Konkurse miterlebt: Einmal hat es den FavAC erwischt, dann den Wiener Sportclub, später, als ich bereits Trainer war, dann auch noch den FC Lustenau. Das sind Phasen, wo du monatelang kein Geld siehst. Natürlich hatte ich da Existenzängste - denn was ich als junger Mensch verdiente, habe ich mit vollen Händen ausgegeben. Als meine Frau dann zum ersten Mal schwanger war, entschied ich mich fürs normale Berufsleben, um meiner Familie eine gewisse Sicherheit zu bieten. Ich kannte Spieler, die hatten acht, neun Monate lang kein Geld bekommen, die konnten ihren Kindern nicht einmal Milupa kaufen, ganz zu schweigen von der Bezahlung der Stromrechnungen. Ich werde nie vergessen, wie schwer es war, Profifußballer zu sein - wobei wir trotzdem schon immer das Image hatten, prassende Millionäre zu sein.
Heißt das, der durchschnittliche österreichische Fußballer ist entgegen der landläufigen Meinung gar nicht überbezahlt?
Ich glaube, dass die Menschen viele Zahlen, die sie aus dem internationalen Fußball hören, automatisch auf Österreich umlegen - aber das stimmt einfach nicht. Ein Zweitligaspieler arbeitet heutzutage für 1200 Euro brutto, und auch bei vielen Bundesligavereinen wird kaum die 4000-Euro-Marke überschritten. Mein Sohn Marcel ist jetzt 19 und auf dem Sprung zu einer Profikarriere. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es ihm wünschen soll, für diese Beträge sein normales Berufsleben auf später zu verschieben. Wenn jemand eine vernünftige Berufskarriere verfolgt und nebenbei Fußball spielt, dann geht es ihm in den seltensten Fällen schlechter als einem österreichischen Fußballprofi.
Und wovon lebten Sie nach Ihrer aktiven Laufbahn?
Über den ehemaligen Wiener SPÖ-Gemeinderat Karl Dampier habe ich einen Job als Hausbesorger bei der Sozialbau AG bekommen, das war eine gut bezahlte Arbeit, für die ich heute noch dankbar bin, ich hatte eine Dienstwohnung und 14 Gehälter. In den Köpfen vieler Menschen hat sich durch diverse Fernsehserien ein ziemlich spezielles Hausmeisterbild manifestiert, das kaum der Realität entsprach. Mittlerweile gibt es keine Hausmeister mehr, aber ich denke, dass viele Menschen noch heute dankbar für einen Job wie diesen wären.
Was hat Sie dieser Job für Ihre Tätigkeit als Trainer gelehrt - den Umgang mit Menschen?
Ja, der Umgang mit Menschen taugt mir, ich war schon immer jemand, der sehr gerne kommunizierte. Und ich möchte den Spielern auch etwas von meiner Lebenserfahrung mitgeben.
Bildet eine Fußballmannschaft denn gesellschaftliche Wirklichkeiten ab, repräsentiert sie einen Querschnitt unserer Gesellschaft?
Das denke ich schon.
Warum gibt es dann im Profifußball zum Beispiel keine Schwulen?
Die wird es geben, davon bin ich überzeugt. Grundsätzlich ist mir das wurscht, ich akzeptiere jeden Menschen so, wie er ist.
Sie erwähnten zuvor Ihren 19-jährigen Sohn Marcel, der mit 16 aus der Vorarlberger Fußballakademie direkt in den Nachwuchs des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wechselte. Beschleicht Sie als Vater nicht manchmal das Gefühl, dass Ihr Sohn seine Kindheit ...
... dem Fußball opferte? Das hat er. Ich wollte als Vater da sein, wenn er Rat braucht, aber ich habe mich in seine Fußballkarriere nicht eingemischt. Ich war eigentlich nie streng, nie autoritär - nur einmal, als es darum ging, ihm Werte zu vermitteln: Das war in der Zeit, als ich in Moskau arbeitete und erstmals genug Geld verdiente, um ihm die Armani-Jacke zu kaufen, die er sich so sehr gewünscht hatte: Da bemerkte ich, dass er mit ihr in der Schule mit stolzgeschwellter Brust auf und ab marschierte, so nach dem Motto: "Mein Papa verdient in Russland großes Geld, schaut, wir sind reich!" Da habe ich die Jacke genommen, vor seinen Augen zerrissen und gesagt: "Mach so was nie wieder!"
Hat Ihr Exempel gewirkt?
Und wie! Heute kommen mir vor Respekt fast die Tränen, wenn ich über den Marcel spreche: Es ist unglaublich, was er in den letzten drei Jahren alles durchgestanden hat und wie er daran als Mensch gewachsen ist: Er hat sich ohne Hilfe bei einem deutschen Topklub bis in die U23-Mannschaft hinaufgearbeitet und nebenbei die Schule abgeschlossen. Es ist wahnsinnig schwer, sich dort durchzusetzen und als Ausländer akzeptiert zu werden, das hätte ich nie geschafft. Er muss mehr Leistung abliefern als die deutschen Kollegen, ist nicht gleichgestellt. Oft haben ihn die Mitschüler im Internat morgens nicht aufgeweckt, damit er die Schule versäumt und bei den Lehrern und Trainern vielleicht nicht so gut dasteht. Ich dachte, er wird den Schritt nach Deutschland bereuen, meine Frau und ich hatten ihn nach ein paar Monaten wieder zu Hause erwartet, weil er den internationalen Fußball ursprünglich ja nur aus dem Fernsehen kannte und dachte, dass ohnehin alles ganz einfach wäre. Aber er hat sich durchgesetzt - und davor ziehe ich meinen Hut.
Sie selbst haben sich ja erst als Trainer einen echten Karriereplan zurechtgelegt.
Karriereplan - so würde ich das nicht nennen. Eigentlich wollte ich ja gar nicht Trainer werden, ich dachte mir: "Wenn die Spieler so sind, wie ich als Junger war, halte ich das überhaupt nicht aus." Aber in Leopoldsdorf im Marchfeld, meiner letzte Station als aktiver Fußballer, hatte ich bereits einen schweren Hüftschaden, konnte nur noch mit Voltaren spielen und hatte kaum noch Lebensqualität. Da hat mich der Obmann überredet, doch als Spielertrainer dabeizubleiben, die Mannschaft zu coachen und nur noch selbst auf dem Platz zu stehen, wenn es meine körperliche Verfassung zulässt. Als Neo-Trainer habe ich dann gleich die ersten sechs Matches verloren, und das hat mich verrückt gemacht. Deswegen habe ich dann auch mit der Trainerausbildung begonnen: Ich machte es, um die Schande dieser Niederlagen auszubügeln. Von meinen letzten sieben Spielen in Leopoldsdorf habe ich dann fünf gewonnen - und das war kein Zufall, denn Zufall gibt es keinen.
Es gibt keinen Zufall?
Es gibt auch kein Glück und kein Pech - das beeinflusst du selber, das alles geht nur über Arbeit.
Wer viel arbeitet, ist gut, wer wenig arbeitet, ist schlecht - ist es wirklich so einfach?
Man kann Gewinnen und Verlieren lernen, das hat etwas mit dem vegetativen Nervensystem und dem Solarplexus zu tun. Grundsätzlich will jeder gewinnen, eh klar. Nur: Jeder hat das Gewinnen anders gelernt. Der eine kommt aus der untersten Schicht, aus einem schwierigen Elternhaus, der andere hat einen Papa, der Architekt ist und Porsche fährt. Das sind ganz verschiedene Welten, in denen jeder anders um ein Ziel kämpft, und die Kunst eines Trainers besteht nun darin, diesen Weg zu vereinheitlichen - nur so kann ein großes Ziel erreicht werden.
Was brachte Sie zu dieser Erkenntnis?
In der Zeit, als ich beim Wiener Sportclub in der Regionalliga kickte, hatte ich eine Bekannte, die sich in Richtung Mentaltrainerin entwickelte und zu mir sagte: "Du, Damir, gib mir eine Chance, ich würde gerne mit dir arbeiten." Ich: "Geh, hör auf, ich weiß alles, kann alles, mir braucht keiner was zu erklären." Aber dann habe ich doch mitgemacht - und sie wollte von mir, dass ich mir drei Ziele stecke. Damit wusste ich anfangs nicht viel anzufangen, für mich war ein Match ein Match, alles lief nach dem Zufallsprinzip, so tickte der Damir damals. Dann setzte ich mir also drei Ziele: Ich wollte beim bevorstehenden Cupspiel gegen den haushohen Favoriten Casino Salzburg - damals im Europacupfinale - der beste Spieler am Platz sein. Außerdem wollte ich ein Angebot aus der Bundesliga bekommen. Und ich wollte in einem körperlichen Topzustand sein. Ich habe mir also drei persönliche Ziele gesetzt. Wir haben das Spiel dann nach einer Topleistung ganz knapp mit 0:1 verloren. Tags darauf hat mich der damalige Bundesligaverein GAK kontaktiert, in der "Krone" las ich: "Canadi bester Mann am Platz", und auch körperlich war ich in einem guten Zustand. Da dachte ich mir: "Na servas, gibt's jetzt Geister?" Doch dann sah ich, dass man sich konzentrieren und fokussieren muss, um Energien zu bündeln - und das gilt für individuelle Ziele ebenso wie für Mannschaftsziele.
Sind Sie ein religiöser Mensch?
Ja, auch wenn ich nicht jeden Sonntag in die Messe gehe.
Und - ist Rapid nun eine Religion?
Für die Menschen aus dem Fanbereich, die ich bisher kennenlernte, definitiv. Die überziehen teilweise sogar ihr Konto, um auch bei einem Auswärtsmatch dabei zu sein. Respekt, so viel muss dir dein Verein erst einmal wert sein!
Nun hat der Arbeiterklub Rapid also endlich wieder einen Trainer, der die Sorgen der kleinen Leute aus eigener Wahrnehmung kennt - war das Teil der Job Description?
Nein, das glaube ich nicht. Es war meine Entwicklung als Trainer, die den Ausschlag gab. Im Gegensatz zu manchen Kritikern glaube ich nämlich nicht, dass Rapid eine Nummer zu groß für mich sein könnte. Der Verein hat gewartet, bis ich groß genug für Rapid war.
Damir Canadi
Der neue Rapid-Trainer wurde am 6. Mai 1970 in Wien geboren. Als aktiver Fußballer war er - abgesehen von Kurzengagements bei Austria Wien, VfB Mödling und Vienna - nur bei unterklassigen Vereinen tätig, in seiner zwölfjährigen Laufbahn spielte er bei zwölf verschiedenen Klubs. Erst als Trainer stellten sich sportliche Erfolge ein: Canadi führte den Vorarlberger Underdog SC Rheindorf Altach in der Saison 2014/15 auf Platz drei der Bundesliga - das war die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Als Canadi am 11. November 2016 aus dem Ländle zu Rapid wechselte, rangierten die Vorarlberger auf dem zweiten Tabellenplatz.
Kommentare
wie cool ist denn das...da verwendet der NEWS-Reporter bei seiner ersten Frage an Damir Canadi meinen Satz über Damir..na DAS gefällt mir.. "Er weiß wohin er will, weil er nicht vergessen hat, woher er kommt". ...obwohl mein Brief lt. meiner Statistik schon halb Österreich gelesen hat - für die paar die ihn noch nicht kennen...hier zum Nachlesen..https://briefevongerd.wordpress.com/2016/05/13/brie